Von Susan Bonath.
Reiche werden reicher, Arme ärmer. Damit das so bleibt, gibt’s das passende Feindbild
Lungert der Rumäne traditionell als Diebesbande im Wald herum? Betteln viele Roma kraft ihrer Gene? Und: Sind sämtliche aus Nordafrika stammenden Männer potentielle Sexstraftäter? Die (unaufgeklärten) Kölner Überfälle haben die politische Debatte um »böse« und »gute« Kulturen, um Herkunft und Hautfarbe, um schützens- und unwertes Dasein verschärft. Forderungen wie »Ausländer raus« erreichen die deutsche »Mitte«. An abgefackelte Asylheime hat man sich gewöhnt. AfD, NPD, Die Rechte und freie Kameradschaften marschieren gemeinsam durch die Straßen, im Schlepptau Hunderte »besorgte Bürger«. Politik und Medien ziehen mit. Oder eilen voraus. Die Propagandamaschine läuft – subtil oder in Stürmer-Manier. Die Republik unterteilt wieder in Rassen statt Klassen – eine gefährliche Verdrehung der Realität.
Propaganda
Autos kosten Geld. Versicherer, Öllobby und kommunale Knöllchenjäger teilen nicht ein in arm und reich.Auch Werkstätten tun dies nicht. Trotzdem sind viele Niedriglöhner, vor allem in ländlichen Gebieten, auf ein Fahrzeug angewiesen. Für sie geht’s um Lohn oder Betteln beim Hartz-IV-Amt, um »Ehre« oder Stigmata. In diesen ohnehin vorhandenen Frust platzte kürzlich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit einer Forderung nach einer weiteren Benzinsteuer. Natürlich: Zur Finanzierung der Flüchtlingspolitik. Sagt er zumindest. Denn: Bezahlbaren Wohnraum für alle oder öffentlich geförderte Arbeitsstellen meint er damit keineswegs. Er will, so erklärte er gegenüber der Rheinischen Post, »Abwehrstrategien finanzieren«.
»Flüchtlingshilfe« à la Schäuble sind monströs gesicherte Schengen-Außengrenzen, bis an die Zähne bewaffnete EU-Einheiten und Geld für die Türkei, wo 2,5 Millionen syrische Migranten leben. Kein Wunder: Die bayrische Schwesterpartei CSU und die AfD jubeln ihm zu. Grüne und Linke zicken, SPD-Chef Sigmar Gabriel auch, doch dann tritt nach: Die nordafrikanischen Maghreb-Staaten sollten Abgeschobene leichter einreisen lassen. Sonst müsse man über Sanktionen nachdenken. Und die Düsseldorfer Polizei verkündet im Springer-Blatt »Welt online«: Man werde von nun an »Härte gegen nordafrikanische Kriminelle« zeigen. Das Bild von marodierenden Banden mit dunklen Schöpfen setzt sich in des Lesers Kopf.
Krieg, Hunger, trotzdem »sicher«
Die Empörungswellen voller Hass auf »Asylanten« wogen in den Kommentarspalten der Onlinemedien. Dass Merkel schließlich verkündet, Schäubles Benzinsteuer sei vom Tisch, zieht an den Schreibern vorbei. Im Parlament läuft derweil die Abschiebedebatte zu neuen Hochtouren auf. Die CSU will nicht nur Indien, Algerien, Armenien, Marokko, Tunesien und die Republik Moldau als weitere »sichere Herkunftsländer« einstufen, sondern auch die kriegsgeschüttelten Staaten Mali und die Ukraine. Als solche behandelt wird letztere offenbar schon jetzt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bestätigte am Dienstag einen Zeitungsbericht, laut dem von 7.100 ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die 2014 und 2015 einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt hatten, nur 5,5 Prozent anerkannt oder vorläufig geduldet werden. Der Rest erhalte Abschiebebescheide. Das heißt: Betroffene müssen auf schnellstem Weg aus Deutschland raus, ansonsten gelten sie als »illegal«.
Die Auschwitz-Überlebende und Musikerin Esther Bejerano (91), die noch immer mit der Gruppe »Mikrophone Mafia« auftritt und Vorträge in Schulen hält, sprach in einem Interview am vorvergangenen Wochenende von »bedenklichen Parallelen« zu den 1930er und 40er Jahren. »Auch damals haben viele europäische Staaten die Grenzen dicht gemacht und Flüchtlinge ausgewiesen«, erinnerte sie sich. Betroffen gewesen sei auch die Schwester der Jüdin, die vor den deutschen Faschisten in die Schweiz geflohen sei. »Sie haben sie zurückgeschickt, an der Grenze wurde sie erschossen«, so Bejerano.
Pingpong zwischen Feindbildern
Die Anschläge in Paris und die Übergriffe in Köln hatten vor allem eine Wirkung: Sie etablierten das Feindbild Nummer eins: Flüchtlinge. Mensch mit dunklem Teint traut sich kaum noch auf die Straße. Angriffe auf mutmaßliche Muslime oder Brandanschläge auf von ihnen bewohnte Gebäude melden die Medien bereits seit über einem Jahr fast täglich. Antiasyldemonstrationen, größtenteils angeführt von Funktionären der NPD, AfD oder der Partei Die Rechte, sind Programm. In den Kommentarspalten unter jenen Artikeln dominiert bedenkliche Verharmlosung. Selbst Mordversuche werden gerechtfertigt. Das Feindbild Flüchtling hat das seit Jahren politisch etablierte vom »faulen Sozialschmarotzer« – gemeint sind Hartz-IV-Bezieher – überholt. Die bekannten Endlosdiskussionen darum, ob letztere unter Androhung noch schärferer Sanktionen zum Arbeiten gezwungen werden sollen, ob Rumänen und Bulgaren ein Existenzminimum zusteht oder nicht, ob die Polizei verpflichtet sei, hilfesuchende Obdachlose unterzubringen oder nicht, laufen, wenig beachtet, nebenher. In diesen spielen Politik und diverse Organisationen vor allem abgehängte Gruppen gegeneinander aus. Forderungen nach einer allgemeinen Kürzung der staatlichen Leistungen zur Finanzierung der Flüchtlinge werden laut. Die Aufhebung des Mindestlohns und die Anhebung des Renteneintrittsalters werden verlangt. Rechte Gruppen schreien, man dürfe nur noch Deutsche unterstützen. In der Vergangenheit hatten letztere bekanntermaßen auch nicht viel für »reinrassige« Hartz-IV-Bezieher oder Obdachlose übrig. Diverse AfD-Wünsche nach einer Pflicht zum Organverkauf oder einer Aufhebung des Wahlrechts für Arme hallten vor nicht allzu langer Zeit durchs Internet, während Obdachlose auf den Straßen verprügelt wurden.
Kapitalinteressen
All diese öffentlich geführten Debatten mit dem Zweck, »Schuldige« zu orten, gehen am Thema vorbei. Sie stilisieren Opfer globaler Verwerfungen zu »den Tätern« schlechthin. Sie manipulieren Symptome zu Ursachen. Ausgeblendet bleiben die rigorose Ausplünderung ganzer Landstriche, der tobende Kampf um Verteilung und Teilhabe, Hunger und Elend, militärische Aufrüstung zur imperialen Markteroberung und traumatisierte Bevölkerungen.
Um die Auswirkungen globaler Verwerfungen zu erfassen, kann eine am Montag veröffentlichte Studie der Organisation Oxfam herhalten. Ihr Ergebnis überrascht nicht: Gut 70 Millionen Menschen auf diesem Planeten besitzen inzwischen so viel wie die restlichen 99 Prozent. Den 62 reichsten Einzelpersonen gehört so viel, wie den ärmeren dreieinhalb Milliarden Menschen: 1,76 Billionen Dollar oder 1,61 Billionen Euro. Ihr Vermögen wächst rasant, alleine in den vergangenen fünf Jahren um 44 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank das Gesamtvermögen der ärmeren Hälfte unserer Population um 41 Prozent auf rund eine Billion Dollar, obwohl heute 400 Millionen Menschen mehr als vor fünf Jahren auf der Erde leben. Zugleich leidet knapp eine Milliarde Menschen extremen Hunger. Alle fünf bis zehn Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung.
Während global wie national stattfindet, was Karl Marx und andere Philosophen systembedingte Kapitalakkumulation nannten, erzählen deutsche und europäische Politiker den Menschen, es seien die Flüchtlinge, die unserer Sozialsystem, unsere Gesellschaft bedrohten.
Konkurrenz global und national
Dass der Kapitalismus zyklische Krisen erzeugt, bestreiten heute selbst Marktradikale nicht mehr. Problem ist der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung des Mehrwerts. Um ein Unternehmen zu halten, müssen die Profite sprudeln. Ansonsten kann kein Betrieb überleben. Denn die Konkurrenz lauert. Größere Unternehmer machen kleinere über den Preis platt. Um niedrige Preise zu halten, muss ein Konzern ständig wachsen und mehr produzieren. Nur so kann er seine Waren billiger verkaufen und sich dauerhaft halten. Ist kein Wachstum (mehr) möglich, bleibt nur noch das Drücken der Löhne. In der Regel werden beide Strategien gefahren. Die Folgen: Die Kaufkraft der Lohnabhängigen sinkt. Das Steuerbudget des Staates wird kleiner. Der spart zuerst an Sozialausgaben. Das Budget der Bedürftiger und Rentner wird kleiner. Auch ihre Kaufkraft sinkt. Es entsteht eine Überproduktionskrise, die ab einem bestimmten Punkt nicht mehr durch politische Marktregulation zu lösen ist, sondern nur noch durch imperiale Eroberungskriege. Erobert werden Herrschaft über Märkte, Ressourcen, Bodenschätze, billige Arbeiter. Dieses Spiel ist so global wie der Markt. Es ist nur logisch, dass perspektivlos gewordene Menschen irgendwann den Kapitalströmen folgen. Dass sie dorthin abwandern, wo die Regale gefüllt sind.
So global die Konkurrenz ist, so national ist sie ebenfalls. Konkurrenten sind wir alle: Unternehmer gegen Unternehmer, Lohnarbeiter gegen Lohnarbeiter, Erwerbslose gegen Erwerbslose. Deutsche konkurrieren gegen Migranten um Jobs, Männer konkurrieren gegen Frauen, alt konkurriert gegen jung. Es herrscht das Recht des Stärkeren. Wer dominiert wen? Wer bekommt die Arbeitsstelle, wer die Wohnung? Die Konkurrenz begegnet uns am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, in der Schule, auf der Einkaufsmeile.
Oben gegen unten
Eins zeigt die Geschichte deutlich: Mit der Ungleichheit zwischen arm und reich werden die Verteilungskämpfe schärfer. Verrohung und Kriminalität wachsen mit der gesellschaftlichen Ausgrenzung unterschiedlicher Gruppen. Am Zenit dieser Entwicklung sind wir noch nicht angekommen. Aber wir stecken mittendrin. Die Front verläuft zwischen oben und unten. Der geflüchtete Lohnabhängige leidet am selben Problem wie der deutsche, ob beschäftigt oder erwerbslos. Doch politisch gewollt, dominiert nicht die Klasse, sondern die Rasse die Debatte. Ein Ablenkungsmanöver. Rassenkämpfe, religiös konnotiert oder nicht, gab es in der Geschichte zuhauf. Sie führen nicht ans Ziel, sondern mehren das Elend am unteren Ende. Den Reichen sichern sie weitere Machtzyklen. Denn es herrscht Klassenkampf. Von oben. Seit Jahrhunderten.
Danke an die Autorin für das Recht zur Veröffentlichung des Artikels.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.







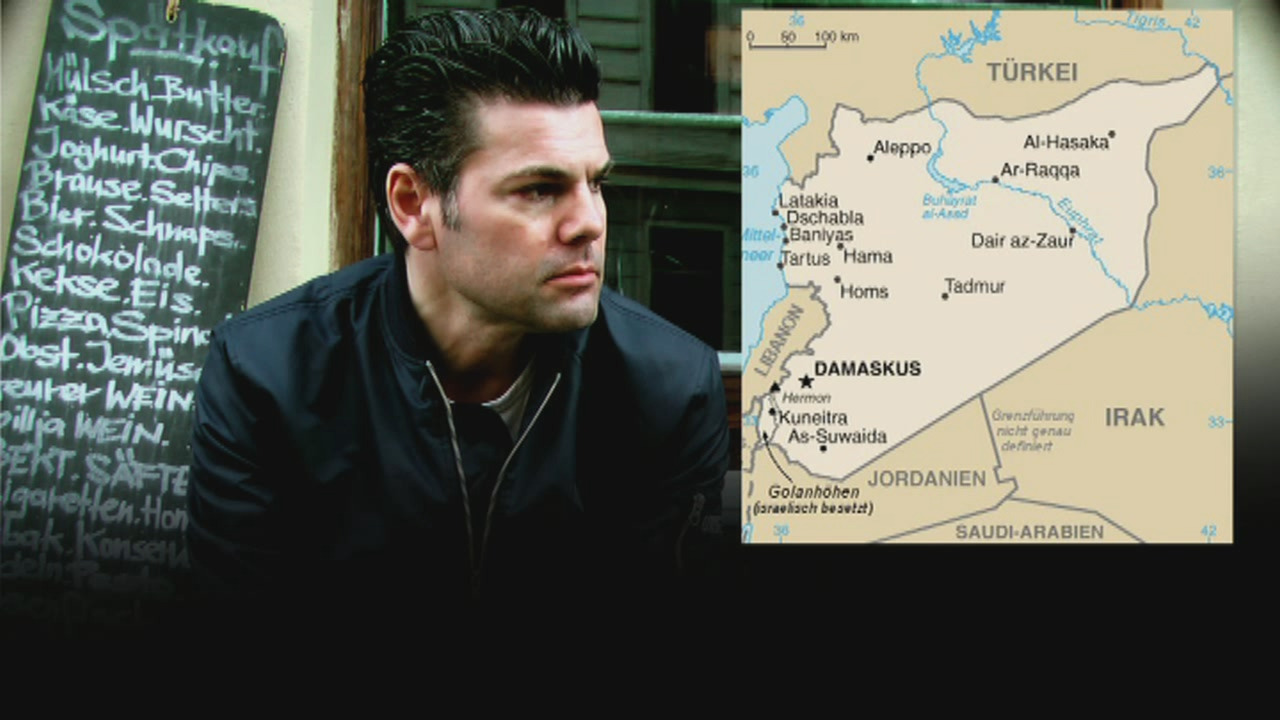
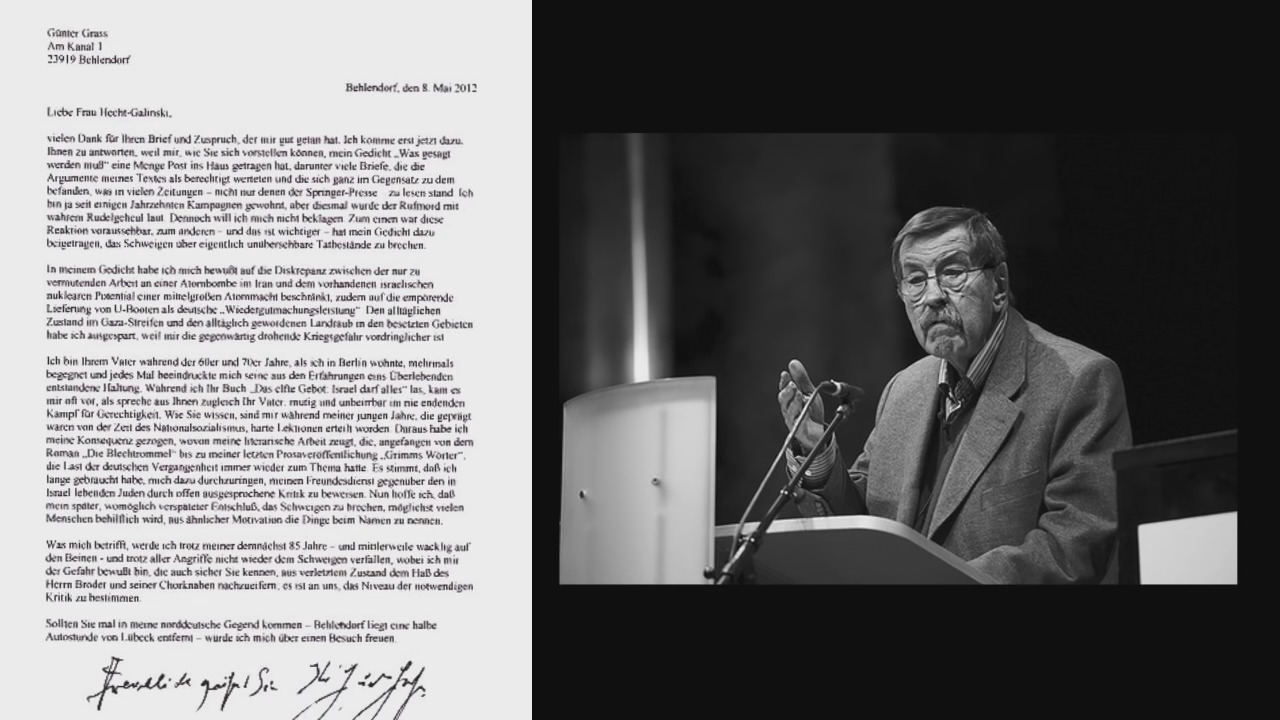

Kommentare (1)