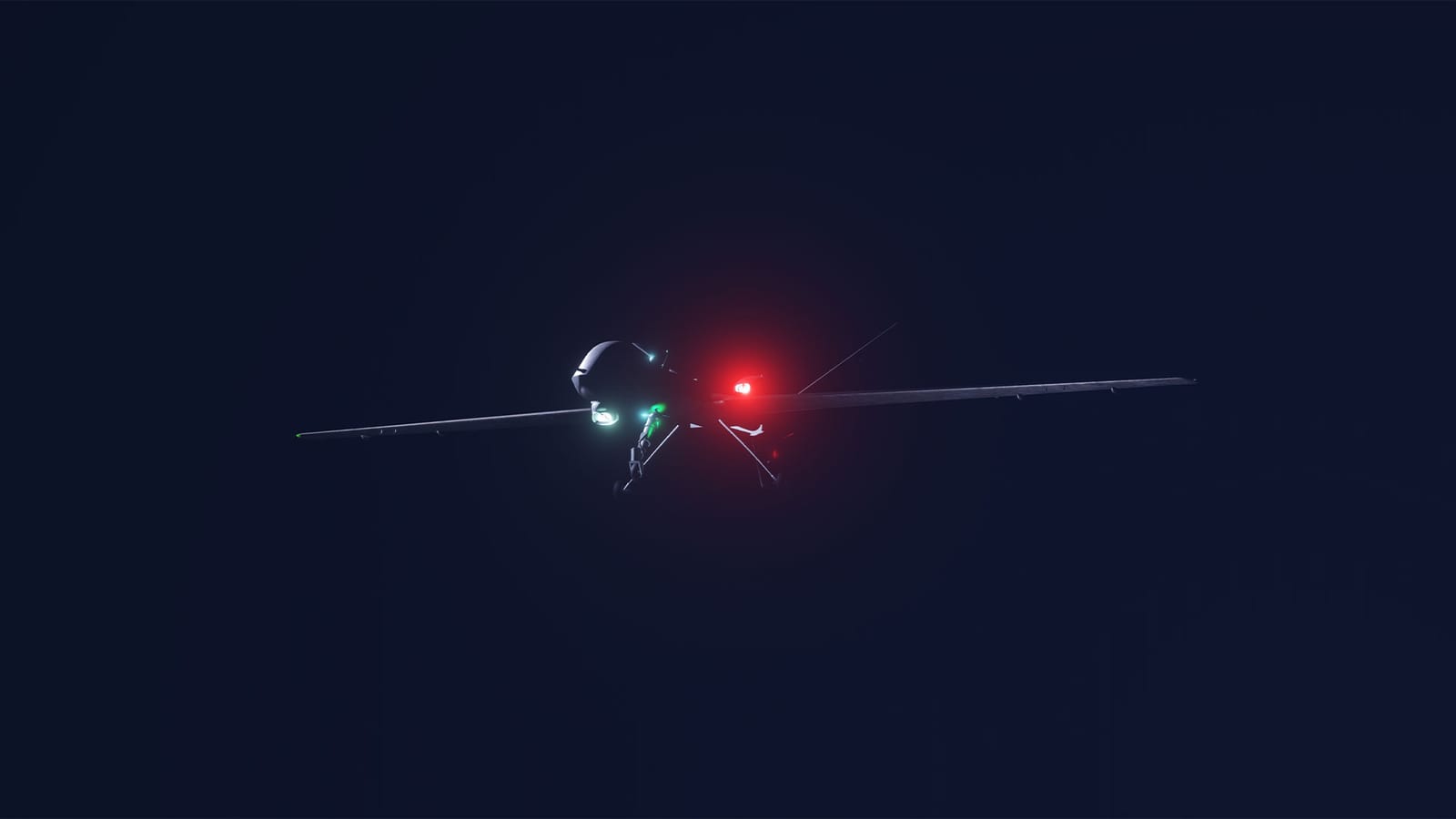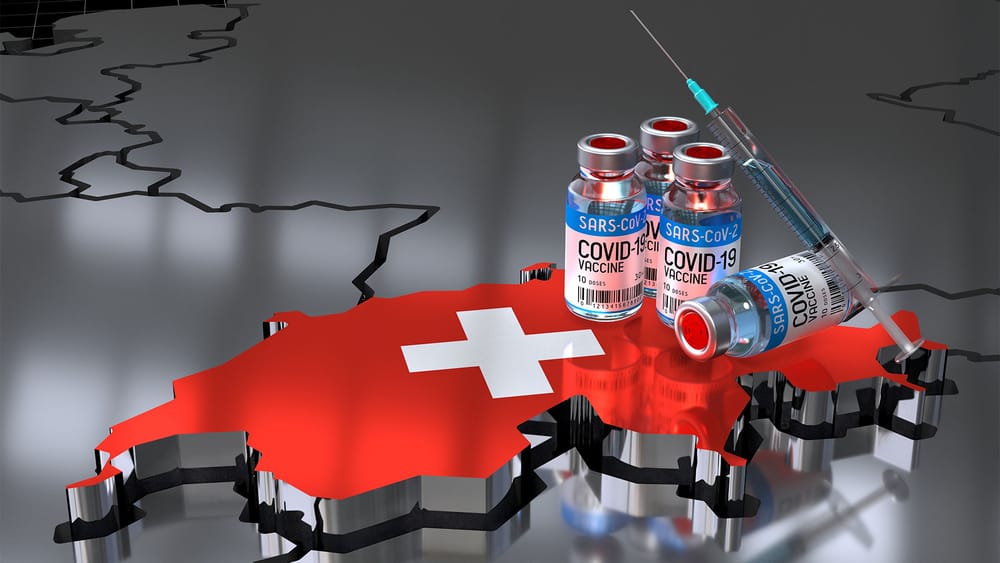Wie anonyme Drohnen zu politischen Werkzeugen werden
Ein Meinungsbeitrag von Günther Burbach.
Noch bevor die erste Radarspur sauber ausgewertet ist, steht in der Regel schon fest, wer verdächtigt wird. Ein unidentifiziertes Flugobjekt über der Ostsee, ein Licht am Himmel über einem Hafen, ein unerklärlicher Flugpfad in der Nähe eines Flughafens und schon liegt die Erzählung bereit: „hybrid“, „wahrscheinlich russisch“, „Test unserer Verteidigung“. Der Ablauf ist eingeübt. Erst die Eilmeldung, dann die Talkrunde, am Ende die Pressekonferenz. Zurück bleibt das Gefühl, wir hätten etwas verstanden. In Wahrheit haben wir nur eine Deutung übernommen.
Dass dieses Muster nicht nur über Seegebieten greift, zeigt sich seit Jahren im zivilen Luftraum. Immer wieder kommt es zu Störungen an Flughäfen, Start- und Landebahnen werden gesperrt, der Betrieb unterbrochen, weil Drohnen gemeldet werden. Manchmal gibt es Bilder, manchmal nur Sichtungen. Oft lässt sich später nicht mehr rekonstruieren, was da tatsächlich unterwegs war: eine private Kamera-Drohne, ein Ballon, ein Reflex, ein technischer Fehlalarm. Trotzdem wandert der Vorfall sofort in die große Schublade „Sicherheitslage“. Flughäfen sind sensible Symbole, wie Häfen und Raffinerien auch. Wenn dort etwas Unklareres passiert, kippt es automatisch in die politische Sphäre. Das Ereignis selbst wird zur Staffage; entscheidend ist die Linie, die man daraus ziehen kann.
Technisch betrachtet ist vieles an diesen Vorfällen banal und vieles unklar. Der zivile und militärische Luftraum ist in Mitteleuropa dicht überwacht; wer ernsthaft unsere Reaktionszeiten testen wollte, täte das möglichst unauffällig. Beleuchtete Hobbydrohnen, die jemand am Handy filmt, taugen eher als Angstgenerator denn als militärisches Werkzeug. Selbstverständlich gibt es ernsthafte, hochentwickelte Systeme, die sich auch unentdeckt bewegen können. Aber deren Zweck ist gerade nicht, Schlagzeilen zu produzieren. Sie sammeln Informationen, nicht Emotionen. Das heißt: Wenn wir in der Öffentlichkeit von Drohnen hören, hören wir in der Regel von genau den Vorfällen, die kommunikativ anschlussfähig sind, nicht unbedingt von denen, die militärisch relevant sind.
Damit beginnt das eigentliche Problem: die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Unsicherheit erzeugt Reichweite. Eine „unidentifizierte Drohne“ ist die perfekte Geschichte, weil sie gleichzeitig konkret wirkt, ein Ding am Himmel, eine Bahnblockade, ein Blaulicht und abstrakt bleibt: Niemand weiß genau, was es war, also passt jeder seine Ängste hinein. Politik kann an solche Situationen hervorragend andocken. Je unklarer die Faktenlage, desto leichter lassen sich Maßnahmen begründen. Das gilt für mehr Technik am Zaun, für größere Budgets, für strengere Regeln im Luftraum. Und es gilt genauso für den Ton. Wer in der Demokratie führen will, muss handlungsfähig klingen. Unsicherheit verträgt das nicht. Also wird Unschärfe mit Gewissheit beantwortet.
Das ist keine Unterstellung, sondern eine Kommunikationslogik, an die sich alle gewöhnt haben. Ministerien, Behörden, Redaktionen, Nachrichtenagenturen, jeder hat seine Rolle. Der Beamte darf nichts Falsches sagen, der Sprecher nichts offenlassen, der Redakteur keine Leerstelle senden. Also füllt man die Leerstelle mit dem wahrscheinlichsten Narrativ. In der derzeitigen Lage ist das häufig Russland. Nicht, weil man es wüsste, sondern weil es als Erklärung schnell auf dem Tisch liegt. Ein Teil der Öffentlichkeit verlangt nach dieser Eindeutigkeit, weil komplexere Antworten, „wir wissen es noch nicht“, „es könnte vieles gewesen sein“, als Ausweichen gelesen werden. So entsteht ein Kreislauf: Je mehr Unklarheit, desto mehr Gewissheitston. Je mehr Gewissheitston, desto weniger Platz für Prüfung.
Wer hier journalistisch arbeiten will, muss sich der Versuchung entziehen, sofort Täterkarten zu verteilen. Das bedeutet nicht, blauäugig zu sein. Es bedeutet, die technischen und organisatorischen Ebenen zuerst zu sortieren: Welche Sensoren haben überhaupt etwas gesehen? Gibt es korrelierte Daten, Radar, Funk, Wärme? Wurde ein Objekt verfolgt, abgefangen, identifiziert? Wie sah die Kette der Entscheidungen im Tower oder im Lagezentrum aus, wer hat gesperrt, warum, auf welcher Grundlage, wie lange? Gibt es Videomaterial, das mehr zeigt als Lichtpunkte? Wurden Kommunikationsfrequenzen gestört? Wer hat intern welchen Begriff verwendet, bevor die Öffentlichkeit informiert wurde? Diese Fragen sind mühsam und wenig glamourös. Aber erst sie trennen Vorfall von Erzählung.
Die Flughafenseite ist besonders heikel. Dort reichen häufig subjektive Sichtungen, um den Betrieb aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen. Das ist korrekt, Vorsicht geht vor. Aber das führt zwangsläufig zu Fehlalarmen. Wärmeflimmern, Vögel, Ballons, reflektierende Objekte, Drohnen in weiter Entfernung, die gar nicht den Platz betreffen: all das kann im Live-Betrieb zu gleich klingenden Meldungen führen. Gleichzeitig nimmt im Umfeld von Flughäfen der Einsatz privater Drohnen für Filmaufnahmen, Inspektionen oder schlicht Spielerei zu. Die Abgrenzung wird dadurch nicht leichter. Ein moderner Sensorpark kann helfen, aber auch der produziert Falschpositive, gerade wenn er an die Wahrnehmungsschwelle geht. Die Folge sind „Events“, die politisch wirken, ohne dass man später beweisen könnte, was da tatsächlich flog.
Auch die maritime Infrastruktur liefert Beispiele. Über Seegebieten werden in Küstennähe Drohnen gemeldet, über Ankerplätzen, an Windparks, in der Nähe von Pipelines. Einiges davon ist denkbar, vieles plausibel, manches anekdotisch. Dass Geheimdienste und Militärs solche Räume interessieren, ist trivial. Dass private Firmen zu Messzwecken und Inspektionen fliegen, ebenfalls. Dass Sabotagevorgänge möglich sind, hat die jüngere Vergangenheit gezeigt. Aber aus dem Möglichen das Bestimmte zu machen, das ist der Sprung, der in der Öffentlichkeit viel zu schnell gelingt. Wenn man ehrlich ist, bleibt bei wichtigen Fällen oft mehr Verunsicherung zurück als Wissen. Je größer der politische Sprengstoff, desto dichter die Nebelwand. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die übliche Reibung zwischen Geheimhaltung, Diplomatie und PR.
Die psychologische Komponente wird unterschätzt. Gesellschaften, die mehrere Krisen hintereinander erlebt haben, gewöhnen sich an Alarm. Der Alarm erzeugt Zugehörigkeit. Er schafft ein „wir“ gegen „die“. Er stiftet Sinn in Zeiten, in denen Regeln und Versprechen brüchig werden. Und er liefert ein Raster, in das jedes unerklärte Ereignis passt. Ein Licht am Himmel ist dann nicht mehr ein Licht, sondern ein Signal. Eine Bahnblockade ist nicht mehr eine Blockade, sondern ein Test. Eine Pressekonferenz ist nicht mehr eine Auskunft, sondern ein Ritual der Beruhigung und Mobilisierung. Wer in diesem Klima fragt, ob die Ursache vielleicht profan war, bekommt schnell die Rolle des Spielverderbers. Dabei ist genau diese Frage der Schutzmechanismus der Demokratie: die Pflicht, Zweifel auszuhalten, ohne in Relativismus zu flüchten.
Historisch ist das alles nicht neu. Der Kalte Krieg war voll von „Zwischenfällen“: Flugzeuge, die vom Kurs abweichen; Manöver, die missverstanden werden; Übungen, die für Angriffspläne gehalten werden. Damals dauerte es Tage, manchmal Wochen, bis sich die offizielle Lesart stabilisierte. Heute passiert das in Stunden. Das Internet beschleunigt nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Verdichtung. Die erste Deutung bleibt hängen, auch wenn sie später korrigiert wird. Und jede Korrektur wirkt dann wie ein Eingeständnis von Schwäche. Dabei wäre genau das Gegenteil richtig: Wer Unsicherheit öffentlich macht, erhöht die Glaubwürdigkeit der späteren Sicherheit.
Das heißt nicht, dass Bedrohung nie real wäre. Es heißt, dass sie nicht dadurch realer wird, dass wir sie schneller behaupten. Wer ernsthaft glaubt, die NATO-Abwehr würde im offenen Betrieb mit offensichtlichen Hobbydrohnen getestet, muss erklären, wozu die Sichtbarkeit dienen soll. Wer annimmt, jede Drohne sei gezielt gesetzt, muss erklären, warum jene Vorfälle mit klarer Beweislage so viel seltener sind als jene, die im Nebel bleiben. Wer sofort „Russland“ sagt, sollte die Alternativen vorher abgeklopft haben: Eigenversuche zur Reaktionsmessung, kommerzielle Flüge, Fehlalarme, bewusstes „Noise“, um Systeme zu Stresstesten und ja, auch die Möglichkeit, dass jemand im Zweifel will, dass wir aus einem unklaren Vorfall eine klare Drohgeschichte machen. Das gehört zum Pflichtprogramm nüchterner Prüfung.
Die Flughafenfälle sind eine gute Schule für diese Haltung. Wer dort arbeitet, weiß: Die Linie zwischen Vorsicht und Überreaktion ist dünn. Wer zu spät sperrt, riskiert Leben. Wer zu früh sperrt, riskiert Vertrauen. Beide Fehler kosten. Es hilft niemandem, diese Dilemmata politisch aufzuladen. Besser wäre es, die Fragen offen zu adressieren: Wie viele Meldungen gab es im Jahr? Wie viele wurden verifiziert? Welche Sensoren lagen zugrunde? Wie sehen die internen Protokolle aus, wann wird gesperrt, wie wird aufgehoben? Welche Technik hat sich bewährt, welche erzeugt zu viele Falschalarme? Wie sind die Schnittstellen zwischen Luftaufsicht, Polizei, Bundeswehr? All das sind langweilige Fragen, aber sie machen eine Öffentlichkeit robust. Ohne sie bleiben wir beim Reflex.
Dasselbe gilt für die See. Auch hier: Wie viele Meldungen? Wie viele Bestätigungen? Welche Behörden haben welche Kompetenz? Wer führt, wer folgt? Wie gehen zivile Betreiber, Hafen, Energie, Windpark, mit Vorfällen um? Werden Daten archiviert und unabhängigen Prüfern zugänglich gemacht? Gibt es standardisierte Berichte oder nur Pressemitteilungen? Man muss diesen Teil der Arbeit tun, wenn man nicht von Fall zu Fall an Narrative ausgeliefert sein will. Die Alternative ist ein Dauererregungszustand, der immer eine Antwort parat hat, aber selten die richtige.
Am Ende bleibt die nüchterne Feststellung: Vielleicht erfahren wir bei manchen prominenten Vorfällen nie, wer was gesteuert hat. Das kann an Geheimhaltung liegen, an diplomatischen Rücksichten, an echten Lücken in der Beweislage. Manchmal ist die Wahrheit schlicht nicht herstellbar. Aber das gibt niemandem das Recht, aus Unkenntnis Sicherheit zu machen. Es verleiht auch keiner Seite moralische Immunität. Und es entbindet Journalisten nicht von der Pflicht, das Naheliegende gegen das Wahrscheinliche zu testen und beides gegen das Belegbare.
Für die Praxis heißt das: Wir müssen die Ereignisse aus der Nähe beschreiben, ohne sie vorschnell zu deuten. Wir müssen zeigen, wie Entscheidungen im Betrieb getroffen werden, im Tower, im Lagezentrum, auf der Wache. Wir müssen die Kette dokumentieren: Sichtung, Verifikation, Kommunikation, Maßnahme, Entwarnung. Wir müssen genau sagen, an welchen Punkten Hypothesen in Gewissheitswörter umkippen. Und wir müssen Gegenhypothesen offenhalten, auch wenn sie weniger gut verkaufen. Das ist zäh, trägt aber weiter als die hundertste Empörungsrunde.
Vielleicht liegt die neue Sichtweise genau darin: nicht noch eine Schuldthese, sondern die Rekonstruktion der Mechanik hinter den Thesen. Nicht die Drohne, sondern das System, das aus ihr Politik macht. Nicht die große Metapher, sondern die kleinen Abläufe, die erklären, warum aus Lichtpunkten am Himmel bedeutungsschwere Ereignisse werden. Wer diesen Blick einmal einnimmt, sieht auch, wie schnell wir uns selber füttern: mit Alarm, mit Schlagworten, mit der Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen. Und wie wenig davon trägt, wenn man das Licht am Himmel einfach mal als das nimmt, was es zunächst ist: etwas, das man erst prüfen muss, bevor man es deutet.
Vielleicht ist das der eigentliche Test, den uns anonyme Drohnen abverlangen, nicht den der Abwehrsysteme, sondern den unseres Urteilsvermögens. Wie lange wir aushalten, „wir wissen es noch nicht“ zu sagen. Wie bereit wir sind, die banale Erklärung ernsthaft zu erwägen. Wie aufmerksam wir bleiben, wenn die einfache Erzählung lockt. Wer darauf eine ehrliche Antwort findet, braucht weniger Schlagworte. Und vielleicht, nur vielleicht, auch weniger Drohnen, über die man reden muss.
Quellen:
Multiple drone sightings reported in Germany in past three days – Reuters über Zwischenfälle an Flughäfen & Militärstandorten in Deutschland. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/munich-runways-closed-again-pilot-blames-drone-sightings-2025-10-03/
How Europe might tackle the threat of drone incursions at airports – Bericht über Drohnenvorfälle in mehreren Ländern (Dänemark, Schweden, Deutschland), technische Herausforderungen & Regulierung. https://www.reuters.com/world/drone-incursions-what-can-airports-do-prevent-them-2025-10-10/
Drone sightings prompt call for German police to gain shoot-down powers – Drohnenmeldungen führten zu Forderungen, Polizei das Abschießen von Drohnen zu erlauben (z. B. in München). https://www.reuters.com/world/europe/drone-sightings-disrupt-munich-airport-halt-flights-impact-thousands-2025-10-03/
BMI – „Stärkerer Schutz von kritischer Infrastruktur vor illegalen Drohnen“ Pressestelle Bundesministerium des Innern und für Heimat. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/01/luftsicherheit.html
Handelsblatt – „Drohnen: Der neue Krieg – und was er mit Deutschland macht“ Artikel, der beschreibt, wie Drohnen die Kriegsführung verändern und welche Herausforderungen sich für Deutschland ergeben. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/drohnen-der-neue-krieg-und-was-er-mit-deutschland-macht/100160510.html
Frankfurt: 35 Drohnen-Vorfälle im Jahr 2025 – WELT Meldung über konkrete Vorfälle am Frankfurter Flughafen, mit Zahlen zu Störungen. https://www.welt.de/article68d665ee24619b7e72e50a8f
Deutschland rüstet auf im Anti-Drohnen-Kampf – FR Artikel über Rechtslage, Zuständigkeiten und geplante Maßnahmen in Deutschland. https://www.fr.de/politik/neue-regeln-neue-waffen-so-ruestet-deutschland-im-anti-drohnen-kampf-auf-zr-93968059.html
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Militärische Drohne bei Nachtflug
Bildquelle: isoprotonic / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut