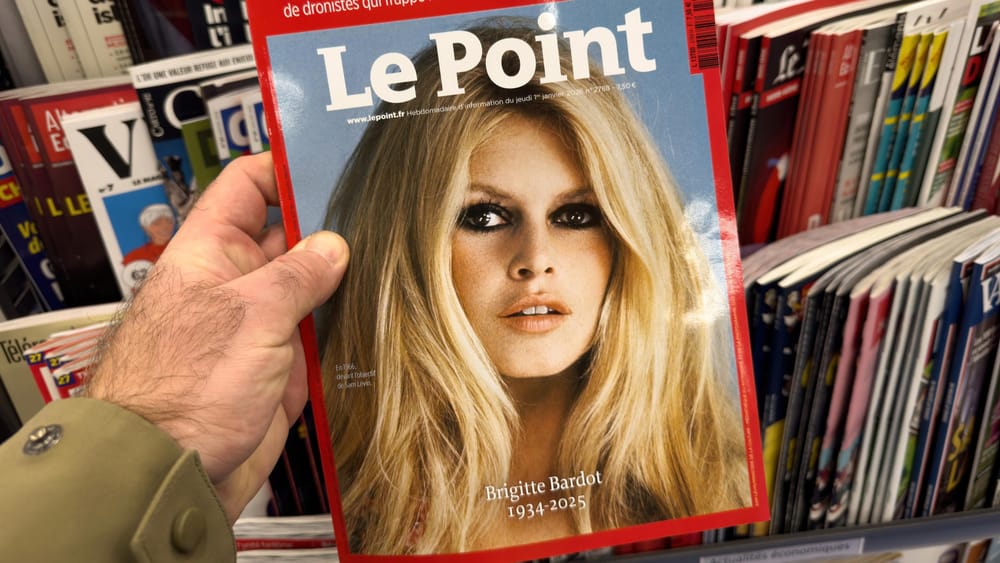Den Siegern gelingt die Verankerung des Narrativs vom imperialen Deutschland
Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger.
"Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben" – ein häufig zitierter Satz, der sich in Deutschland mächtig und nachhaltig entfaltet hat. Insbesondere wurde die Darstellung Deutschlands als imperialistische Großmacht nach beiden Weltkriegen maßgeblich von den Siegermächten geprägt und tief im kollektiven Gedächtnis Europas und der Welt verankert. Dieses Narrativ hat nicht nur die Wahrnehmung deutscher Geschichte und Identität beeinflusst, sondern auch politisch und gesellschaftlich tiefe Auswirkungen auf Deutschland selbst gehabt. Vor allem den Briten gelang es, das Bild vom „imperialen Deutschland“ zu etablieren, und es gilt, aufzuzeigen, welche Funktion diese Narration erfüllt hat und welche Folgen dies für Deutschland und seine Erinnerungskultur hat.
Maßgeblich an diesem "Erfolg" beteiligt war der heute noch von Vielen als Pazifist und Anhänger der sozialistischen Fabian-Society gefeierte britische Propagandist und politische Intellektuelle H.G. Wells (1866–1946).
Die wirkmächtige Propagandaarbeit des Briten H.G. Wells
H.G. Wells war vor allem für seine Science-Fiction-Romane wie „Die Zeitmaschine“ und „Krieg der Welten“ bekannt. Weniger bekannt, aber von großer Bedeutung für die geistige Neuausrichtung Deutschlands nach 1945, ist Wells’ Rolle als Propagandist und Popularisierer von Weltgeschichte. Seine Werke zielten darauf ab, Nationalismus, Militarismus und die überholten politische Ordnungen der Gegner des Empire zu überwinden und stattdessen ein universales Geschichtsverständnis im Sinn eines anglo-amerikanischen Imperiums, wie es Cecil Rhodes vorschwebte, zu fördern. (1)
So wie Rhodes oder Bertrand Russell (1872–1970) träumte H. G. Wells (1866–1946), von einem perfekten Weltstaat mit einem
»ethischen System«, welches »die Fortpflanzung dessen begünstigt, was in der Menschheit fein, wirksam und schön ist – schöne und starke Körper, einen klaren und mächtigen Geist und einen wachsenden Wissenskörper – und ... die Fortpflanzung von niederen und unterwürfigen Typen, von angstgetriebenen und feigen Seelen, von allem, was in den Seelen, Körpern oder Gewohnheiten der Menschen gemein, hässlich und bestialisch ist, kontrolliert“ (2)
Der irische Dramatiker George Bernard Shaw (1856–1950) nahm offenbar für die eugenische Verbesserung der Menschheit sogar Gaskammern in Kauf:
»Wir sollten uns verpflichtet fühlen, sehr viele Menschen zu töten, die wir jetzt am Leben lassen, und sehr viele Menschen am Leben zu lassen, die wir gegenwärtig töten. Wir sollten alle Ideen über die Todesstrafe loswerden müssen ... Ein Teil der eugenischen Politik würde uns schließlich zu einer umfassenden Nutzung der Totenkammer verhelfen. Sehr viele Menschen müssten aus dem Leben gerissen werden, nur weil es die Zeit anderer Menschen verschwendet, sich um sie zu kümmern.« (3)
Derartige Träumereien und Wells vornehme Zurückhaltung bezüglich der zahlreichen Kolonialkriege und der Kriege zur Sicherung und Expansion des britischen Weltreiches (Konflikte in Indien, Afrika und dem Nahen Osten) seit 1871, sind augenfällig. Großbritannien kontrollierte das größte Kolonialreich und war aktiv global militärisch präsent.
Wells Verständnis für Großbritanniens brutales Vorgehen im 2. Burenkrieg (1899-1902) im Sinne des zivilisatorischen Auftrags Britanniens – lässt seine imperialkritische Haltung Deutschland gegenüber in einem anderen Licht erscheinen – und ihn keineswegs als Pazifisten dastehen. (4) Auch in seinem Times-Artikel vom 5. August 1914 argumentierte Wells nicht wirklich pazifistisch, sondern plädierte für einen entschlossenen Krieg gegen das Deutsche Reich, das er als Ursache von Militarismus und „böser Philosophie“ sah. Der Krieg erschien ihm notwendig, um eine neue, friedliche Weltordnung herzustellen. (5)
Ganz anders der französische Sozialist Jean Jaurès, der sein Land am 30. Juli 1914 kritisierte:
»Hier in Frankreich arbeiten wir mit allen Gewaltmitteln für einen Krieg, der ausgefochten werden muß, um ekelhafte Begierden zu befriedigen, und weil die Pariser und Londoner Börsen in Petersburg spekuliert haben … Es liegt an der Macht der französischen Regierung, Russland am Kriege zu hindern, aber man sucht den Krieg, den man schon lange schürt.« (6)
Am 4. August 1914 um 23.30 Uhr wurde dem deutschen Botschafter in London die britische Kriegserklärung übergeben. Bereits in den frühen Morgenstunden des 5. August hob die britische Navy vor Emden das deutsche Atlantikkabel und schnitt ein längeres Stück heraus.
»Engländer, tut Eure Pflicht und haltet Euer Land aus einem bösen, dummen Krieg heraus. Kleine aber mächtige Cliquen versuchen, Euch hineinzuziehen. Ihr müsst die Verschwörung heute durchschauen oder es wird zu spät sein.«
Auf der gleichen Seite war weiter zu lesen:
»Wenn wir uns auf die Seite Russlands und Frankreichs stellen würden, wäre das Kräfteverhältnis so gestört, wie es noch nie zuvor war. Es würde das militärische russische Reich von 160 Millionen zur dominierenden Macht Europas machen. Sie wissen, was für ein Land Russland ist.«
Bereits in den frühen Morgenstunden des 5. August 1914 – also nur wenige Stunden nach der Kriegserklärung erschien in der Times der Artikel von H.G. Wells am Ende von vier Tagen, in denen Generalmobilmachungen und nachfolgende Kriegserklärungen einander ablösten:
»Nie war ein Krieg so gerecht, wie der Krieg jetzt gegen Deutschland. [Das militärische Ergebnis] wird innerhalb der nächsten zwei oder drei Monate mehr oder weniger endgültig entschieden. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wird der deutsche Imperialismus zerstört sein, und es ist möglich, das Ende der Rüstungsphase der europäischen Geschichte vorwegzunehmen. Russland wird zu erschöpft sein für weitere ›Abenteuer‹. Das zerschlagene Deutschland wird revolutionär sein … Jetzt ist das Schwert für den Frieden gezogen.« (7)
Pazifist H.G. Wells zog das Schwert für den "Frieden"!
„ ... nachdem am 28. Juni das östreichische Thronfolgerpaar in Sarajewo von serbisch-bosnischen Nationalisten ermordet worden war und dieses Ereignis in einer politischen Kettenreaktion die angestauten kapitalistischen Widersprüche zur Explosion gebracht hatte“, (8) so der Mitherausgeber der gesellschaftskritischen Theoriezeitschrift Krisis, begann die Entfesselung des Ersten Weltkriegs, den der US-amerikanische Historiker George F. Kennan treffend als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat.
Deutschland im 19. Jahrhundert
Wiener Kongress – Paulskirche – Reichseinigung
Nach den Napoleonischen Kriegen ordnete der Wiener Kongress (1814-1815) Europa und Deutschland neu. Dabei wurde statt eines Nationalstaats der Deutsche Bund gegründet, ein loser Zusammenschluss von 37 Fürstentümern und vier freien Städten, der monarchische und restaurative Prinzipien betonte und liberale Forderungen unterdrückte. Österreich hatte nach den Bestimmungen der Deutschen Bundesakte die Führungsrolle; ihm stand der Vorsitz im Bundestag zu.
Gleichzeitig gab es jedoch eine Rivalität mit Preußen, das ebenfalls eine Machtposition anstrebte. Diese Rivalität, auch als „Deutscher Dualismus“ bezeichnet, prägte die Geschichte des Bundes. Preußen war vor allem wirtschaftlich führend im "Deutschen Zollverein" (1834), der – ohne Österreich – für einen einheitlichen Wirtschaftsraum und die Abschaffung von Handels-Zöllen zwischen den Mitgliedstaaten eintrat. Diese Gegensätze führten später zu Konflikten, die im Deutschen Krieg 1866 gipfelten, nach dem Preußen die Vormachtstellung übernahm und der Deutsche Bund aufgelöst wurde. (9)
Der Versuch, Deutschland mittels der revolutionären Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt (1848) mit einer liberalen Verfassung als föderalen Verfassungsstaat zu einen, scheiterte an der Gegenwehr preußischer und anderer Fürstenmächte. (10)
Die Reichseinigung wurde erst später, 1871, durch Preußen unter Leitung Otto von Bismarcks vollzogen, als das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde und die einzelnen Fürstentümer sich unter preußischer Führung zusammenschlossen. Diese Reichsgründung folgte auf drei Kriege und eine Politik des „Blut und Eisens“ und vollendete die nationale Einigung Deutschlands unter preußischer Dominanz im Kaiserreich.
Bereits drei Wochen nach der Kaiserproklamation am 18. Januar 1871 in Versailles hielt der spätere britische Premier Benjamin Disraeli (1874-1880) in einer Londoner Parlamentsdebatte am 9. Februar 1871 eine beachtenswerte Rede – nachfolgend die Kernsätze:
«Ich möchte die Aufmerksamkeit des Unterhauses auf den Charakter dieses Krieges zwischen Frankreich und Deutschland lenken.
Dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts.
Nicht ein einziger Grundsatz unserer Außenpolitik, der noch vor sechs Monaten von allen Staatsmännern als Leitfaden anerkannt wurde, ist weiterhin gültig.
Wir haben eine neue Welt, neue Einflüsse am Werk, neue und unbekannte Größen und Gefahren, mit denen wir fertig werden müssen und die zur Zeit, wie alles Neue, noch undurchschaubar sind.
Wir haben früher in diesem Haus über das Gleichgewicht der Macht debattiert. Lord Palmerston, ein in hohem Maße praktischer Mann, hat das Staatsschiff und seine Politik daraufhin ausgerichtet, daß das Gleichgewicht Europas erhalten bleibe [...] Aber was ist jetzt wirklich geschehen?
Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört worden und das Land, das am meisten darunter leidet und das die Auswirkungen dieses großen Wandels am meisten spürt ist England.» (11)
Damit war Disraeli (1804-1881) seiner Zeit voraus. Doch ab 1887 wurde zielstrebig darauf hingearbeitet (Neuer Kurs), „neue und unbekannte Größen und Gefahren“ abzubauen.
Nach heutigem Narrativ scheint es kaum vorstellbar, dass das ganze 19. Jahrhundert, besonders unter den Intellektuellen, eine Periode von deutscher Anglophilie war, die erstaunlich wäre, wenn nicht die Deutschen ihre innenpolitischen Wunschbilder immer in anderen Ländern suchen würde, in den 1920er Jahren waren es die Nationalisten in Italien, die „Kommunisten“ in Russland und stets die Demokraten in England.
Zu den wenigen, die England gegenüber einen klaren Blick behielten, gehörte u.a. der deutsche Wirtschaftstheoretiker, Diplomat und Eisenbahnpionier Friedrich List (1789-1846). Als sich die Voraussagen und Hoffnungen von List, der auch den Zollverein gründete) erfüllten, als Deutschland sich zu einem mächtig aufstrebenden Industrieland entwickelte und damit überall auf der Welt auf englische Schranken stieß, da begann, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, eine gewisse Ernüchterung, die sich während des Burenkriegs zum Englandkoller auswuchs. In den ersten Jahren des Weltkriegs machte sich die furchtbare Enttäuschung über den „englischen Vetter“, den man sich als Kriegsgegner gar nicht hatte vorstellen können, dann auch angesichts seiner diabolischen Propaganda in einer Erbitterung ohnegleichen bemerkbar. Es war die kurze Zeit des
„Gott strafe England!“. (12)
Nach der Reichsgründung unter preußischer Führung war Deutschland zu einer Großmacht in Europa aufgestiegen. Der Prozess der Industrialisierung, der militärische Ausbau und der imperialistische Wettlauf um Kolonien und Einflusszonen führten dazu, dass Deutschland als eine der zentralen Mächte in das System der europäischen Großmächte integriert wurde – und nun ebenso außenpolitische Ambitionen verfolgte, ja den Wunsch nach einem „Platz an der Sonne“ angeblich aggressiv durchsetzte. Dieses verkürzte Zitat von Bernhard von Bülow, immer gern als Beweis des deutschen Strebens nach der Weltmacht angeführt, lautet jedoch vollständig: (13)
„Mit einem Worte: wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“ (14)
Absichtlich aus dem Kontext gerissen, verliert dieses Zitat die diplomatische Nuancierung. (15)
Ursprünglich wandte sich Bülow gegen den Eindruck, Deutschland wolle andere Mächte dominieren, er betonte aber zugleich das Recht Deutschlands auf seinen eigenen „Platz“ bzw. Einflussbereich (vor allem in Übersee) neben den etablierten Kolonialmächten wie Großbritannien und Frankreich.
Nach seiner Thronbesteigung im Frühjahr 1888 wurde Kaiser Wilhelm II., Enkel der britischen Queen Victoria, in England gern als Symbol des preußischen Militarismus vorgestellt und sein Auftreten vor allem ideologisch als Ausdruck einer militaristischen und expansiven Politik interpretiert. Ein Jahr nach seiner Thronbesteigung ernannte seine Großmutter ihn zum britischen Admiral der Flotte. Wilhelm II. war darüber sehr erfreut und trug mit Stolz diese Uniform bei offiziellen Gelegenheiten, was seine enge familiäre Verbindung zu Großbritannien unterstrich.
Er empfand diese Ernennung als eine symbolische persönliche Ehre, die den engen dynastischen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien entsprach, ohne eine aktive Rolle als britischer Admiral im Sinne eines militärisch operierenden Kommandanten. (16)
Mit der Krüger-Depesche – ein Telegramm, das Kaiser Wilhelm II. am 3. Januar 1896 an Paul Krüger, den Präsidenten der Südafrikanischen Republik (Transvaal), schickte – gratulierte er Krüger zum Sieg über die britischen Freischärler, die im sogenannten Jameson-Raid versucht hatten, die Unabhängigkeit Transvaals zu untergraben. Das Telegramm enthielt die ausdrückliche Anerkennung der Unabhängigkeit Transvaals und verurteilte die britischen Angreifer als "Friedensstörer". Das traf ja zu. Die britischen Freischärler waren infiltriert worden, um zu gegebener Zeit dem britischen Militär einen Vorwand zum Einmarsch zu liefern, ähnlich wie es die USA bei der "Übernahme" von Texas erfolgreich vorgemacht hatten. In Großbritannien wurde das Telegramm als Beleidigung empfunden und erfolgreich zur Verstärkung antideutscher Ressentiments benutzt. (17) Die Spannungen zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien verschärfte sich erheblich.
Disziplinierung China
Im 19. Jahrhundert führte Großbritannien gegen China zwei Kriege (1839–1842 und 1856–1860), um seine Handelsinteressen und insbesondere den Opiumimport nach China durchzusetzen. Ihr Ergebnis waren sogenannte „ungleiche Verträge“, in denen China unter militärischem und politischem Druck Häfen öffnen, Handelsprivilegien gewähren und territoriale Zugeständnisse an westliche Mächte, auch an Russland und Japan, machen musste. Diese Verträge bedeuteten einen massiven Souveränitätsverlust für China und enorme wirtschaftliche Vorteile vor allem für Großbritannien. Dagegen setzte sich die sogenannte Boxerbewegung um 1900 zur Wehr – eine breit getragene Volksbewegung gegen die ausländischen Einflüsse und Privilegien. Die „Boxer“ sahen sich als Verteidiger Chinas gegen die immer mehr dominierenden europäischen und nordamerikanischen Interessen im Land. Die ausländischen Handelsvertreter, Missionare und die Militärpräsenz – deren Ursprung in den Opiumkriegen bzw. den „ungleichen Verträgen“ lag – galten als Hauptfeind.
Kurzerhand sammelte Großbritannien im Jahr 1900 eine Koalition der Willigen für eine internationale Militäraktion in China (u.a. USA, Deutschland, Frankreich, Russland, Japan), um das Schwinden westlichen Einflusses zu verhindern.
Zur Verabschiedung der Verstärkungseinheiten für das bereits unter britischen Kommandos hart kämpfende deutsche Expeditionskorps hielt Kaiser Wilhelm II. am 27. Juli 1900 in Bremerhaven vor der Abfahrt des deutschen Expeditionskorps zum Boxeraufstand eine Rede, die kam zu Kriegsbeginn 1914 als sogenannte „Hunnenrede“ zur Dämonisierung von Kaiser Wilhelm II. hervorgeholt wurde. Sie lautet im Original:
„Sie werden wie die Hunnen wüten, dass einem Hören und Sehen vergeht. Aber denken Sie daran: kein Gefangener wird gemacht, kein Gramm Pulver wird verschossen, kein Schuss abgegeben, ohne dass er sitzt im Taschenbuch; alles ist durchdekliniert und nichts dem Zufall überlassen; Pardon wird niemand gegeben! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich so verhalten seiteneinwärts, rückhaltlos gegen Ihre Feinde. Sie werden auf solche Weise rücksichtslos kämpfen, dass man sich ewig an Sie erinnert.“
Diese Rede wurde berüchtigt wegen der Aufforderung, keine Gefangenen zu machen und keine Gnade zu zeigen. Die kaum nachvollziehbare Rede lässt jedoch auch eine andere Interpretation zu. Kaiser Wilhelm II. hatte eine Offizierausbildung und mehrere Kommandos inne. Die Befehlssprache ist immer eindeutig. „kein Gefangener wird gemacht“ könnte auch dahingehend ausgelegt werden, dass der Gegner keine Gefangenen macht. Als Befehl hätte es heißen müssen: „Sie machen keine Gefangenen!“ Das gleiche gilt für „es wird kein Pardon gegeben“.
Egal, wie es ausgelegt wird, eine derartige Sprache ist für einen Kaiser nicht angemessen.
Vier Wochen vor der Rede des Kaisers gab der britische Admiral Sir Edward Seymour am 22. Juni 1900 während eines Gefechts nordwestlich von Tientsin/Tianjin den Befehl „Germans to the front“ (deutsch: „Die Deutschen an die Front!“ oder „Die Deutschen nach vorn!“). Die internationale Expeditionsstreitmacht befand sich im schweren Gefecht mit chinesischen Aufständischen. Als die britischen und amerikanischen Truppen, die bis dahin die vorderste Linie gebildet hatten zum Rückzug übergehen mussten, gab Admiral Seymour den Befehl an die deutschen Marineangehörigen, den Durchbruch zu erzwingen und die Führung im Kampf zu übernehmen.
Der Befehl selbst entstand in einer kritischen und gefährlichen Situation des Rückzugs der alliierten Truppen, als ein schneller und entschlossener Vorstoß nötig war, um dem Druck der Aufständischen standzuhalten und einen Zusammenbruch der Verteidigung zu verhindern. Die deutschen Marineeinheiten waren in der Mitte der Formation marschiert, sollten aber jetzt die Spitze übernehmen, um den Kampf für die internationale Expeditionstruppe zu stabilisieren.
Offizielle Befehle zum unmittelbaren Töten aller gefangenen Boxer existierten nicht formal, aber kaiserliche Anweisungen und militärische Praxis führten faktisch zu einer weitgehenden Ausblendung von Schutzpflichten gegenüber Gefangenen und zu zahlreichen Tötungen. Konkret lässt sich keine verlässliche, quantifizierbare Zahl finden, wie viele Boxer vom deutschen Expeditionskorps 1900 im Boxeraufstand getötet wurden. Die Geschichte dokumentiert vielmehr, dass es zu zahlreichen Strafexpeditionen und Vergeltungsschlägen kam, bei denen tausende Chinesen, darunter auch Boxer, starben. Diese Strafmaßnahmen wurden von allen beteiligten Kolonialmächten, einschließlich des Deutschen Reiches, durchgeführt.
Eine genaue Zahl der vom deutschen Expeditionskorps Ermordeten gibt die historische Überlieferung nicht her, und die Quellen sprechen eher von einer kollektiven Schuld aller Kolonialmächte an den Repressionen gegen chinesische Widerstandskämpfer und Zivilbevölkerung.
Bis zur Kriegserklärung Englands am 4. August 1914 spielte die Hunnenrede Kaiser Wilhelms II. in den Medien, insbesondere in Großbritannien, kaum eine Rolle. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich dies schlagartig.
Die britische Kriegspropaganda griff die Rede auf und machte sie zum Symbol für die angebliche Grausamkeit und Militarisierung Deutschlands. In Großbritannien wurde Wilhelm II. mit den „Hunnen“ gleichgesetzt, wobei dessen Rede genutzt wurde, um die Deutschen als barbarisch darzustellen. Dies zeigte sich etwa in der Zeitung The Times, die im August 1914 von einem „Marsch der Hunnen“ berichtete und deutsche Gräueltaten beklagte.
In Deutschland selbst war die Rede zwar bekannt, wurde aber vor allem erst nach dem Krieg international berühmt. Vor Kriegsbeginn war das Interesse an der Rede medial gering, sowohl im Deutschen Reich als auch im Ausland. Mit Kriegsausbruch wurde die Rede, der vor Kriegsausbruch kaum mediale Beachtung geschenkt wurde, als Propagandamittel gegen Deutschland eingesetzt und in der öffentlichen Wahrnehmung, vor allem in Großbritannien und den alliierten Ländern, sehr viel präsenter. (18)
Einschub: Aktuelle Parallele
Wirklich barbarisch hingegen ist die bis heute jedoch kaum bekannte Tötungspraxis von der US-Führung in Afghanistan.
Es gibt Berichte über Einsätze, bei denen Taliban-Kämpfer und Kommandeure im Gefecht getötet wurden, und es existierten Befehle für aggressive Operationen gegen feindliche Kämpfer, darunter auch solche, die den Einsatz tödlicher Gewalt ohne weitere Beweise erlaubten. Ein Beispiel dafür ist ein 2009 bekannt gewordener geheimer Befehl des NATO-Oberbefehlshabers John Craddock, der unter anderem forderte, offensiv gegen Drogenhändler (die Taliban finanziell unterstützten) militärisch vorzugehen, auch ohne weitere Geheimdienstnachweise. Dieser Befehl stieß innerhalb der NATO auf Kritik, auch wegen der Rechtswidrigkeit und der Gefahr für Zivilisten.
Das gezielte Töten von Taliban-Kommandeuren im Gefecht war Teil militärischer Strategie und Kampfhandlungen, aber ein expliziter Befehl, Gefangene sofort zu töten (vergleichbare Situation mit dem Boxeraufstand von 1900), ist nicht nachzuweisen.
Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die deutsche Militärführung im Zusammenhang mit Einsätzen in Kunduz, Afghanistan, taktische Überlegungen und „Gedankenspiele“ anstellte, wie Befehle oder restriktive Vorgaben im Umgang mit Taliban-Kommandeuren umgangen werden könnten.
Berichte und Untersuchungen zeigen, dass im deutschen Einsatzgebiet Situationen bestanden, in denen der Umgang mit gefangengenommenen Taliban-Kommandeuren problematisch war, besonders aufgrund restriktiver Richtlinien und rechtlicher Beschränkungen. In diesen Fällen wurde offenbar in Betracht gezogen, bei bevorstehenden Kampfhandlungen norwegische Truppen einzubeziehen, weil diese militärisch aggressiver agierten und keine so großen Skrupel gehabt hätten, Taliban-Kommandeure gezielt zu töten.
Diese Praxis wurde kritisch beobachtet und diskutiert, da sie eine Umgehung deutscher rechtlicher und ethischer Beschränkungen bei der Behandlung von Gefangenen darstellte. Solche Maßnahmen illustrieren die Spannungen zwischen militärischer Effektivität, rechtlichen Vorgaben und ethischen Standards im modernen Kriegseinsatz.
Diese Informationen sind unter anderem in Berichten über deutsche Militäreinsätze in Afghanistan und Analysen zu Kunduz dokumentiert und zeigen die komplizierte Lage, in der das Bundeswehrkontingent operierte.
1871 – Deutschland wird zu stark
Der schnelle Aufstieg Deutschlands ab 1871 – so wie heute Chinas – wurde instrumentalisiert, um bei den Regierungen und Bevölkerungen der anderen Großmächte Ängste und Misstrauen auszulösen. Ergebnis waren dann die Allianzen gegen das Deutsche Reich im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Nach dem Krieg verstärkten sich diese Deutungen im Kontext der Schuldzuweisung.
Und doch vermied Deutschland es sogar während des Kriegs instinktiv, England besonders zu treffen ( und Hitler z.B. zitierte England in „Mein Kampf“ mehrfach ausschließlich positiv), und alle Friedensfühler wurden über den Kanal ausgestreckt. Am Kriegsende gar verstand es eine proenglische Propaganda, obwohl doch England noch monatelang die Blockade aufrechterhielt, den Deutschen einzureden, Frankreich sei der Hauptfeind. England würde Deutschland vor Frankreich schützen, hieß es damals. Das hat man gern geglaubt.
Mit Amerika würde sich und wird sich Großbritannien im Ernstfall immer einigen, im Notfall die Seeherrschaft mit ihm teilen, wie es das angelsächsische Gemeinschaftsinteresse gebietet.
Ging es 1914 Großbritannien darum, im Bund mit Frankreich und Russland eine aufkommende europäische Zentralmacht zu verhindern, so gilt es heute, ein starkes, Zentraleuropa beherrschendes Russland zu verhindern, getreu der britischen Politik der „Balance of Power“ (Gleichgewicht der Kräfte). Schon der alte englische „Mutiny Ac“ aus dem 17. Jahrhundert nannt als Zweck des englischen Heeres „the preversation oft he balance of power in Europe“. Das ist typisch für eine Seemacht, die immer nach Brückenköpfen auf den gegenüberliegenden Ufern strebt. In den Landmächten dagegen ist der Zweck des Heeres die Verteidigung der Grenzen und der Schutz der Interessen des Staats oder seiner Bürger. Der Amerikaner Homer Lea führte 1912 in seinem Buch "The Day of the Saxon" aus:
„Die Dauer des Britischen Weltreichs ruht im Grunde auf der Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte in Europa selbst. Dafür muss Großbritannien mit größerer Anstrengung kämpfen als für seine wertvollste Besitzung, denn darauf beruht die Integrität aller seiner Besitzungen.“ (19)
So berief sich Zar Nikolaus II. in seinem Telegramm an König Georg V. vom 2. August 1914 – an diesem Tag führte die russische Kavallerie bereits Aufklärung in Ostpreußen durch –auf das Interesse Großbritanniens am Gleichgewicht der Kräfte in Europa. (20) Am 25. Juli 1914 – an diesem Tag befahl Marineminister Winston Churchill nach einem mehrtägigen Seemanöver der britischen Flotte in die Kriegshäfen einzulaufen (Großbritannien war kriegsbereit) – ging ein Telegramm von Sir Edward Grey an St. Petersburg, in dem zur allgemeinen Mobilmachung aufgefordert wurde. Dieses Telegramm wurde später von Deutschland als eine Art Kriegsanlass interpretiert, da man davon ausging, dass Russland durch die Mobilmachung den Krieg indirekt ausgelöst habe. Das Zusammenspiel dieser diplomatischen Nachrichten illustriert, wie stark das europäische Mächtegleichgewicht und die gegenseitigen Sicherheitsinteressen die Lage im Sommer 1914 bestimmten und wie die schnelle Kette von Mobilmachungen und Kriegserklärungen kaum noch einen Ausweg aus der Eskalation bot. (21)
Der Schwede Rudolf Kjellen hat in seiner bekannten Schrift über die Großmächte und den Weltkrieg darauf aufmerksam gemacht, dass die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts für England stets nur ein Vorhang war, hinter dem es sein planetarisches Übergewicht sicherstellte. Er hat damit keine neue Entdeckung verkündet. Bereits im 18. Jahrhundert sagte Louis Duc de Saint-Simon:
„Während England die Welt mit der tönenden Phrase des Gleichgewichts der Mächte in Europa betäubt, hat es sich die volle Herrschaft über alle Meere und allen Handel angeeignet.“ (22)
Man betrachte das Ergebnis der napoleonischen Kriege, um die Wahrheit dieser Worte einzusehen. eine moralische Beurteilung der Balance-of-Power-Doktrin aus angelsächsischem Mund, wie man sie schärfer wohl nicht fassen kann.
Der US-amerikanische Historiker Sidney Bradshaw Fay (1876–1967) – bekannt vor allem durch seine Arbeit zur Geschichte Preußens und zum Ersten Weltkrieg – lehnte die These von der Hauptschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs ab. Stattdessen wies er auf die komplexen Mechanismen der Bündnissysteme und die Verantwortung mehrerer Länder, insbesondere Österreich-Ungarns, Serbiens und Russlands hin:
„Das Prinzip des Gleichgewichts der Kräfte basiert nicht nur auf Gerechtigkeit und Macht. Es erzeugt universelle Ängste und Eifersüchteleien, und es gibt keinen befriedigenden Weg festzustellen, wann ein wirkliches Gleichgewicht erreicht ist. Jede Gruppe neigt dazu, zu fürchten, dass die gegnerische Gruppe schwerer in der Waage liegt und sucht daher die erste Gelegenheit, das Gleichgewicht zu ihren eigenen Gunsten wiederherzustellen.“ (23)
Für den damaligen Revolutionär Wladimir I. Lenin war die Lage im Februar 1915 klar:
„Wir wissen, dass seit Jahrzehnten die Bourgeoisie und die drei Lumpen - die Regierungen von England, Frankreich und Russland - Vorbereitungen getroffen haben, um Deutschland anzugreifen.“
„Alles deutet darauf hin, daß gewisse Kreise mit dem Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch (Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte) an der Spitze auf einen Krieg gegen Deutschland hinarbeiten. Der Ring ist schon fast geschlossen, es fehlt nur noch der äußere Anlasss, den man schon finden wird. Der Zar ist zu schwach, um diese Katastrophe zu verhindern“, (24)
schrieb der russische Historiker W. W. Antonow.
H.G. Wells’ (1866-1946) zentrale Rolle bei der Marginalisierung der Deutschen als Imperialisten und Friedensstörer (25)
Ohne große Kenntnisse der Hintergründe und Ursachen hatte Pazifist H.G. Wells blitzschnell das Schwert für den "Frieden" gezogen.
Wer war H.G. Wells?
Der in London geborene und aus kleinen Verhältnissen stammende H.G. Wells studierte Biologie bei Thomas Henry Huxley, dem Verfechter des Darwinismus. (26) Später engagierte sich Wells in der 1884 gegründeten "Fabian Society". Eine entscheidende Rolle bei der Zielsetzung und Entwicklung der "Fabian Society" spielte George Bernard Shaw, der einen kleinen Intellektuellenkreis zu einer einflussreichen sozialistischen Denkfabrik formte. (27)
Wells steuerte im ersten Weltkrieg maßgeblich die britische Propaganda
Wells hatte im ersten Weltkrieg starken Einfluß auf die Propaganda im Crewe House, das die Massenpropaganda gegen das Deutsche Reich steuerte. Er betonte, dass die Deutschen empfänglich für systematische Gedankengebäude und imperiale Projekt wie "Mittel-Europa" oder das Projekt der "Berlin-Bagdad-Bahn" seien. In diesen Projekten sah er imperalistische Pläne und eine ideologische und politische Bedrohung für die internationale Ordnung. Diese Begriffe dienten dazu, das Feindbild Deutschland zu schärfen und den moralischen Rahmen für die Kriegs- und Nachkriegspropaganda zu setzen, was auch die späteren Re-Education-Maßnahmen beeinflusste.
Wells empfahl, dem deutschen Imperialismus ein positives Gegenbild in Form eines "Völkerbundes" und der Idee nationaler Selbstbestimmung entgegenzustellen. Nach außen solle Großbritannien betonen, dass es nicht um Vernichtung des deutschen Volkes, sondern um die Brechung imperialer Strukturen gehe, was die Feindbilder polarisierte und langfristig zur Außenseiterstellung Deutschlands beitrug. (28)
Zur Beschreibung des preußischen Nationalismus nutzte Wells Begriffe, die diesen als Ausdruck eines autoritären, militaristischen und exklusivistischen Nationalgefühls charakterisierten. Preußischen Nationalismus und "preußischen Militarismus" sah er als Einheit, da sie seiner Meinung nach auf Gehorsam, Disziplin und einer hierarchischen Staats- und Gesellschaftsordnung beruhten. Dieser Nationalismus war für ihn nicht demokratisch, sondern durch eine starke Militärherrschaft geprägt, die von Aggressivität und expansiven Ambitionen gekennzeichnet war. Welche Belege hatte Wells? Das Kaiserreich hatte von 1871 bis 1914 im Gegensatz zu den „friedlichen“ Großmächten (hier sei nur an den unprovozierten Überfall auf die Burenrepublik 1889/1902 erinnert) kein anderes Land angegriffen und war auch Schlusslicht bei den Rüstungsausgaben. Trotzdem sah Wells im deutschen Nationalismus eine ideologische Rechtfertigung für imperialistische Bestrebungen und eine Gefahr für den internationalen Frieden. Der deutsche Sonderweg, wie er ihn beschrieb, war geprägt von einer Mischung aus einer „kulturellen Überlegenheit“ und einer rigiden, auf Kontrolle und Expansion ausgerichteten Machtpolitik. Dabei war der preußische Nationalismus für Wells ein Motor für Konflikte und als Gegenpol zur liberalen Demokratie und zu internationalen Kooperationsformen zu verstehen.
H.G. Wells unterschied den "preußischen" vom "deutschen Nationalismus" vor allem durch die Betonung der autoritären, militaristischen und exklusiven Charakteristika des preußischen Nationalismus. Während er den preußischen Nationalismus als aggressiv, hierarchisch, stark staatszentriert und militaristisch darstellte, sah er den deutschen Nationalismus in einem weiteren und heterogeneren Kontext.
Der deutsche Nationalismus wurde von Wells eher als eine breite Bewegung verstanden, die nicht nur von preußischer Militärherrschaft geprägt war, sondern auch kulturelle, sprachliche und liberale Elemente umfasste. Deutscher Nationalismus umfasste sowohl national-befreiende als auch kulturelle Identitätsdimensionen, die teilweise demokratische und partizipatorische Vorstellungen beinhalteten – im Gegensatz zum restriktiven "preußischen" Nationalismus, den Wells als rückwärtsgewandt, autoritär und expansionistisch beschrieb.
Ab Mai 1918, in der Endphase des Krieges und unmittelbar in den Vorbereitungen zur Friedensordnung nach 1918/1919, entstand H.G. Wells’ Memorandum über Preußen. Das Memorandum diente als Grundlagendokument für die britische Propaganda im Kampf gegen das Deutsche Reich. Wells formulierte darin eine ideologische Grundlage zur Deutung Deutschlands als militaristische und imperialistische Bedrohung für Europa und die Weltordnung. Wells’ Memorandum zielte darauf ab, den preußischen Militarismus und Imperialismus als Hauptursachen des Krieges und als nachhaltige Gefahr darzustellen, die es zu brechen gelte, um eine neue friedliche Weltordnung zu sichern.
In diesem Zusammenhang sollten das Bild von Preußen als aggressivem, autoritärem Staat und das Narrativ eines militärisch-expansiven "preußischen Imperialismus" zur Legitimation der alliierten Kriegsziele und später auch zur politischen Umerziehung (Re-Education) der Deutschen nach 1945 beitragen.
H.G. Wells Empfehlungen für die Propaganda gegen die Deutschen
Systematische Dämonisierung des preußischen Militarismus und Imperialismus
Wells empfahl, die Deutschen als historisch aggressiv, militaristisch und imperialistisch darzustellen, um ihre internationalen Ziele als gefährlich darzustellen und moralisch zu diskreditieren. Dazu gehörte die Betonung des autoritären, hierarchischen Staatsaufbaus und der expansiven militärischen Pläne.
Aufbau eines klaren Feindbildes
Wells plädierte für die Schaffung eines einheitlichen Bildes von Deutschland als permanenten Bedrohung für den Frieden, verbunden mit Symbolen wie dem „preußischen Militarismus“ und der Idee eines „Mittel-Europa“-Imperiums. Dieses Feindbild sollte in der Bevölkerung verankert und dauerhaft präsent gehalten werden.
Propaganda als politischer Krieg
Er sah Propaganda als ein zentrales politisches Instrument im Krieg zur Schwächung des Feindes, das auch nach dem militärischen Sieg weitergeführt werden müsse, z.B. in Form einer Umerziehung (Re-Education) der deutschen Bevölkerung, um militärische und autoritäre Denkweisen zu bekämpfen.
Förderung von nationalen und internationalen Demokratie- und Friedensidealen
Wells empfahl, positive Werte als Gegenbild zum deutschen Imperialismus zu propagieren, etwa den Völkerbund und nationalstaatliche Selbstbestimmung, um demokratische Alternativen aufzuzeigen und Widerstand gegen den Militarismus zu mobilisieren.
Kommunikations- und Medienstrategien
Das Memorandum legte nahe, Nachrichten, Flugblätter, Presseartikel und öffentliche Reden gezielt einzusetzen, um die Bevölkerung der Alliierten zu überzeugen und die Feinde zu desavouieren.
Diese Methoden dienten insgesamt dazu, den Krieg auf der ideologischen Ebene zu führen, die Moral des Feindes zu untergraben und die eigene Bevölkerung für die politischen Ziele der Alliierten zu mobilisieren.
Die deutsche Propaganda sollte als Instrument der imperialistischen und militaristischen Macht entlarvt und delegitimiert werden.
Weiter sollte ein einheitliches und negatives Feindbild („preußischer Militarismus“) etabliert werden, um die moralische Überlegenheit der Alliierten zu untermauern.
Propagandamaßnahmen sollten koordiniert und intensiviert werden, um die öffentliche Meinung in den Alliierten-Ländern zu mobilisieren.
Die Maßnahmen umfassten den gezielten Einsatz von Medien, Presse und Bildung, um demokratische Werte zu fördern und autoritäre und militaristische Ideologien zu schwächen.
Für genaue Textstellen aus dem Originalmemorandum müssten Primärquellen oder spezialisierte Archivdokumente herangezogen werden, die aktuell öffentlich nicht umfassend zugänglich sind.
Im Ersten Weltkrieg unterstützte Wells’ Werk die britische Kriegspropaganda, indem es die moralische Rechtfertigung für den Krieg gegen Deutschland lieferte und den deutschen Militarismus als Kernproblem darstellte. Nach dem Krieg trug diese Sichtweise zur Gestaltung der Pariser Friedensordnung bei, die darauf abzielte, den deutschen Militarismus zu brechen und Deutschland international zu isolieren.
Während des Zweiten Weltkriegs beeinflussten diese Charakterisierungen wiederum die britische Kriegszielpolitik, die auf einer bedingungslosen Kapitulation Deutschlands bestand, um eine dauerhafte Beseitigung der militaristischen Bedrohung zu gewährleisten. Die britische Politik unter Churchill übernahm die Vorstellung von Deutschland als Gefahr für den Frieden und die Freiheit Europas, die Wells mitgeprägt hatte, was sich in der harten Haltung Großbritanniens gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland widerspiegelte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wells’ Darstellung des preußischen Imperialismus als autoritäre, aggressive Macht die britische politische Strategie und das öffentliche Narrativ gegenüber Deutschland von 1914 bis 1945 maßgeblich beeinflusste. (29)
Wells und die „geistige Neuausrichtung“ Deutschlands nach 1945 (30)
Nach 1945 ging es den Alliierten bei der Re-Education um die geistige Umorientierung der deutschen Bevölkerung – weg von Nationalsozialismus und Militarismus, hin zu demokratischen, rationalen und kosmopolitischen Werten. In diesem Kontext spielte das populäre Geschichtswerk von H.G. Wells, insbesondere „The Outline of History“ (1920) und die gekürzte Fassung „A Short History of the World“ (1922), eine zentrale Rolle. (31)
In Millionenauflage als Teil alliierter Re-Education-Maßnahmen wurden die Geschichtswerke Wells von den Alliierten genutzt, um in Schulen und Bibliotheken eine neue pädagogische Grundlage zu schaffen, die mit der NS-Ideologie bricht und universalistische, humanistische Werte ins Zentrum rückt. (32) und um insbesondere junge Menschen und Lehrkräfte – mit einem neuen, globalen und an den Menschenrechten orientierten Geschichtsbild vertraut machen. (33)
Ziel war die die klare Ablehnung des Nationalismus und der unbedingte Wille zur „Weltbürgerschaft“: (34) Eine Vorbereitung auf die heute von den USA angestrebte „New World Order“, die Winston Churchill in seiner berühmten Albert-Hall-Rede 1947 mit dem Zwischenschritt der europäischen Einigung angekündigt hatte.
Für Wells war der Erste Weltkrieg gerechtfertigt, weil daraus eine bessere Welt, frei von Nationalismus und Militarismus, erwachsen sollte. Er verband den Krieg mit einer utopischer Hoffnung auf Frieden und Abrüstung –
„the war that will end war“. (35)
Den Kriegseintritt der USA von 1917 begründete Wells damit, dass »der Unterseebootskrieg der Deutschen sie auf der Seite der antideutschen Verbündeten« hineingezogen habe, wo sie doch »eben erst begonnen (hatten), nach einer amerikanischen Lösung der Weltprobleme zu suchen«. (36) Doch hatte die massive materielle und finanzielle Unterstützung der Entente durch amerikanische Banken ja erst zu dieser Situation geführt – wie so oft sind die internationalen Krisen durch die USA erst geschaffen worden. Niall Ferguson bringt diese Form von »Krisenbewältigung« auf den Punkt:
»Die eigentliche Rolle Amerikas als Imperialmacht besteht darin, die dafür notwendigen Institutionen dort zu etablieren, wo sie fehlen, wenn nötig – wie 1945 in Deutschland und Japan – mit Militärgewalt.« (37)
Vor diesem Hintergrund regelten die USA im April 1945 mit der Direktive JCS 1067 (Joint Chiefs of Staff Directive 1067), dass Deutschland nicht zum Zwecke seiner Befreiung besetzt wird, sondern als besiegter Feindstaat. (38) Ziel sei nicht Unterdrückung, aber auch keine Förderung eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus über das Notwendige hinaus. Die Besatzungsmacht solle gerecht, aber unnahbar und streng agieren, und eine Verbrüderung mit der deutschen Bevölkerung sei zu unterbinden. Die Direktive JCS 1067 zeigt deutlich, dass die USA Deutschland nicht als befreite Nation sahen, sondern als besiegten Staat, der kontrolliert und beschränkt werden musste.
Re-Education – Deutungshoheit über die deutsche Geschichte
Die propagandistischen Stereotype („preußischer Militarismus“, „imperialistische Ambitionen“) wirkten lange nach: Auch im Zuge der Re-Education nach 1945 wurde das Narrativ vom deutschen Imperialismus und der Notwendigkeit seiner Überwindung zentral verwendet, um eine neue demokratische Identität in Westdeutschland zu etablieren. Die britisch-amerikanische Umerziehungspolitik griff auf viele dieser propagandistischen Elemente zurück – etwa die Notwendigkeit, das deutsche Denken „umzuerziehen“ und als Voraussetzung für internationale Integration und Frieden erscheinen zu lassen. (39)
Literatur und Langzeitwirkung
Wells wurde zum intellektuellen Stichwortgeber für den Begriff „Krieg zur Beendigung aller Kriege“, der die alliierten Ziele moralisch rechtfertigte und als Legitimationsfolie für die politischen Umbau- und Erziehungsmaßnahmen diente, die nach 1945 als „Re-Education“ umgesetzt wurden. Die bewusste Marginalisierung Deutschlands als imperialistischer Störenfried war so sowohl Kriegsstrategie als auch Schlüsselnarrativ für die Nachkriegsordnung. (40)
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die vier Siegermächte – USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich – die uneingeschränkte Kontrolle über das besiegte Deutschland. Auf der Potsdamer Konferenz 1945 einigten sich diese Mächte auf eine gemeinsame Politik gegenüber Deutschland, die Maßnahmen wie Demilitarisierung, Denazifizierung, Demokratisierung und Dezentralisierung umfasste. Deutschland wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt, in denen jede Siegermacht ihre eigene Verwaltung durchsetzte, was die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes grundlegend prägte. (41)
Diese praktische Kontrolle der Siegermächte ermöglichte ihnen auch, den Diskurs über Deutschlands Vergangenheit und seine Rolle als imperialistische Macht maßgeblich zu bestimmen. (42) Die politische und moralische Verpflichtung, das „deutsche Problem“ zu lösen, also die potenzielle Rückkehr zu militaristischen und imperialistischen Ambitionen zu verhindern, war ein wichtiger Beweggrund für die Verankerung des imperialen Narrativs. Dabei wurden nicht nur die offensichtlichen Verbrechen des Nationalsozialismus thematisiert, sondern auch ältere imperialistische Traditionen Deutschlands hervorgehoben, um die Notwendigkeit der strengen Kontrolle und der Nachkriegspolitik zu betonen.
Die Teilung Deutschlands in Bundesrepublik und DDR verlieh diesem Narrativ zudem eine dauerhafte politische Dimension, da beide deutsche Staaten diesen Diskurs für ihre eigene Legitimation nutzten, was von den jeweiligen Besatzungsmächten unterstützt und gefördert wurde. (43)
Das Narrativ vom imperialen Deutschland bot den Siegermächten folgende Vorteile:
- Legitimation der Besatzung: Es rechtfertigte die dauerhafte militärische Präsenz und politische Überwachung durch die Alliierten in Deutschland.
- Begründung der Teilung: Die politische Spaltung Deutschlands wurde durch den gemeinsamen Konsens über die Gefahr eines imperialen Deutschlands abgesichert, was die rivalisierenden Blöcke im Kalten Krieg bestärkte. (44)
- Formung öffentlicher Meinung: In den Besatzungszonen und später in beiden deutschen Staaten wurde eine Geschichtserzählung gefördert, die die Vergangenheit Deutschlands in einem imperialen und aggressiven Licht darstellte – als notwendige Grundlage der Friedenspolitik.
- Instrumentalisierung im Kalten Krieg: Das Bild eines imperialen Deutschlands wurde auch als politisches Druckmittel im Ost-West-Konflikt verwendet, um das eigene Bündnissystem zu stabilisieren und Deutschland als strategischen Schauplatz zu definieren. (45)
- Westorientierung und Integration: Die enge Bindung an die westlichen Bündnisse wie NATO und Europäische Gemeinschaft (später EU) sowie die politische Tradition der Weimarer Demokratie flossen in die Kultur des Westens ein. Sicherheitsbedürfnis und Antikommunismus waren prägende Faktoren. (46)
Die Besatzungszeit legte den Grundstein für zwei sehr unterschiedliche politische Kulturen in Ost- und Westdeutschland. Während im Westen eine demokratische, liberale und marktwirtschaftlich orientierte Gesellschaft entstand, entstand im Osten ein sozialistischer Einparteienstaat mit zentralistischer, staatssozialistischer Kultur. Beide Systeme prägten damit die politische Kultur der Deutschen nachhaltig und hinterließen Wirkungslinien, die bis in die Gegenwart spürbar sind. (47)
Neue Blickwinkel auf den Ersten Weltkrieg
Neuere Forschungen fordern eine differenzierte Betrachtung, die zwar die imperialistischen Elemente anerkennt, aber Deutschland nicht ausschließlich als aggressives „Monstrum“ darstellt, sondern auch innere Zwänge, Machtkonstellationen und internationale Zusammenhänge berücksichtigt. Diese Revisionen sind Teil einer modernen Erinnerungskultur, die versucht, die von den Siegern geprägten einfachen Narrative durch komplexere Darstellungen zu ergänzen.
Das Narrativ des imperialen Deutschlands prägt bis heute die kollektive Erinnerung Europas und Deutschlands selbst. Es geht zurück auf drei Ereignisse: das Ohm-Krüger-Telegramm des Kaisers (1896), Bernhard Bülows Rede vom „Platz an der Sonne“ (1897) und des Kaisers sogenannte Hunnenrede (1900) – insgesamt schon eine sehr fragwürdige Basis. Zumal keine Rede davon war, dass der Kaiser bei seinem 25. Thronjubiläum im Frühjahr 1913 weltweit als Friedenskaiser gefeiert wurde – auch von London.
Das erfolgreich verankerte Bild eines imperialistischen Deutschlands diente jedenfalls als politische und moralische Legitimation für Sanktionen, Kontrollmaßnahmen und Sicherheitsstrategien gegenüber Deutschland. Zugleich beeinflusste es die deutsche Selbstwahrnehmung, trug zur Ausprägung einer selbst- und traditionskritischen, pazifistischen Erinnerungskultur bei und stellte ein Instrument dar, um aggressive Nationalismen zu verhindern.
Gleichzeitig zeigt die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte, dass das Narrativ – wie alle historischen Deutungen – komplexer und pluriformer wird und im Zuge kritischer Historisierung eine differenziertere Sicht provoziert. Das Bewusstsein der Macht von Narrativen und Deutungen ist dabei ein wichtiger Schritt hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Geschichte und Gegenwart.
Wird die Geschichte in die eigene Wiederholung getrieben?
Spätestens seit dem vom Westen orchestrierten Putsch in der Ukraine 2013/14 ist Russland von ähnlichen Einkreisungsängsten geplagt wie Deutschland 1914. Für die Analogiebildung ist es unbedeutend, ob diese Einkreisungsvorstellungen angemessen sind oder nicht; entscheidend ist nur, dass die politische Führung unter ihrem Eindruck handelt. US-Präsident George W. Bush hat 2002 die "Präemptiv-Dokrin" geprägt. Da muss nun keine physische Gewalt mehr drohen, es reicht eine "gefühlte" Bedrohung, um präventiv zuzuschlagen (Ähnlich dem Bethlehemer Kindermord um Christi Geburt).
Ein Blick auf die seit 1991 veränderte Landkarte hilft vielleicht weiter. Wo bis 1991 Sowjetunion war, ist heute ein Glacis des Westens. Die "Erweiterungspolitik" der USA zeigte sich spätestens bei dem völkerrechtswidrigen Angriff (ohne UN-Mandat) auf Restjugoslawien. Der Unterschied zu 1914 liegt nur darin, dass die Akteure damals nicht wussten, was auf sie zukommen würde – heute ist es hinreichend bekannt! So ist nur zu hoffen, dass der Frieden heute nicht mehr so leichtfertig verspielt wird wie damals.
Eine Wiederholung der Geschichte bahnt sich im Ost- und Südchinesischen Meer an. China befindet sich in der undankbaren Rolle, die dem Deutschen Reich einst zum Verhängnis wurde: der internationale Emporkömmling, der nach Anerkennung strebte und sich von Feinden umgeben sah. Und die USA befinden sich in der Rolle der damaligen internationalen Führungsmacht Großbritannien: Sie haben ebenfalls ihren Macht- und Einfluss-Zenit überschritten, agieren aus einer Unsicherheit heraus und werden sich voraussichtlich im Kampf gegen den neuen Gegner erschöpfen. Die unipolare Weltordnung hat sich überlebt - die Zukunft gehört einer multipolaren Friedensordnung.
Teil 1: Vergangenheit zur Ideologie wird: Britanniens unaufgearbeitete Erblast
Teil 3: Die deutsche Ur-Angst vor einem neuen Dreißigjährigen Krieg (1618-48)
Teil 5: WKI: Debüt für die Warburg- und Dullesbrüder (1900-1919)
Teil 6: WKI: Debüt für die Warburg- und Dullesbrüder (1919-1959)
Anmerkungen und Quellen
Wolfgang Effenberger, Jahrgang 1946, erhielt als Pionierhauptmann bei der Bundeswehr tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete "atomare Gefechtsfeld" in Europa. Nach zwölfjähriger Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft sowie Höheres Lehramt (Bauwesen/Mathematik) und unterrichtete bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik. Seitdem publiziert er zur jüngeren deutschen Geschichte und zur US-Geopolitik. Zuletzt erschienen vom ihm „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020) sowie "Die unterschätzte Macht" (2022)
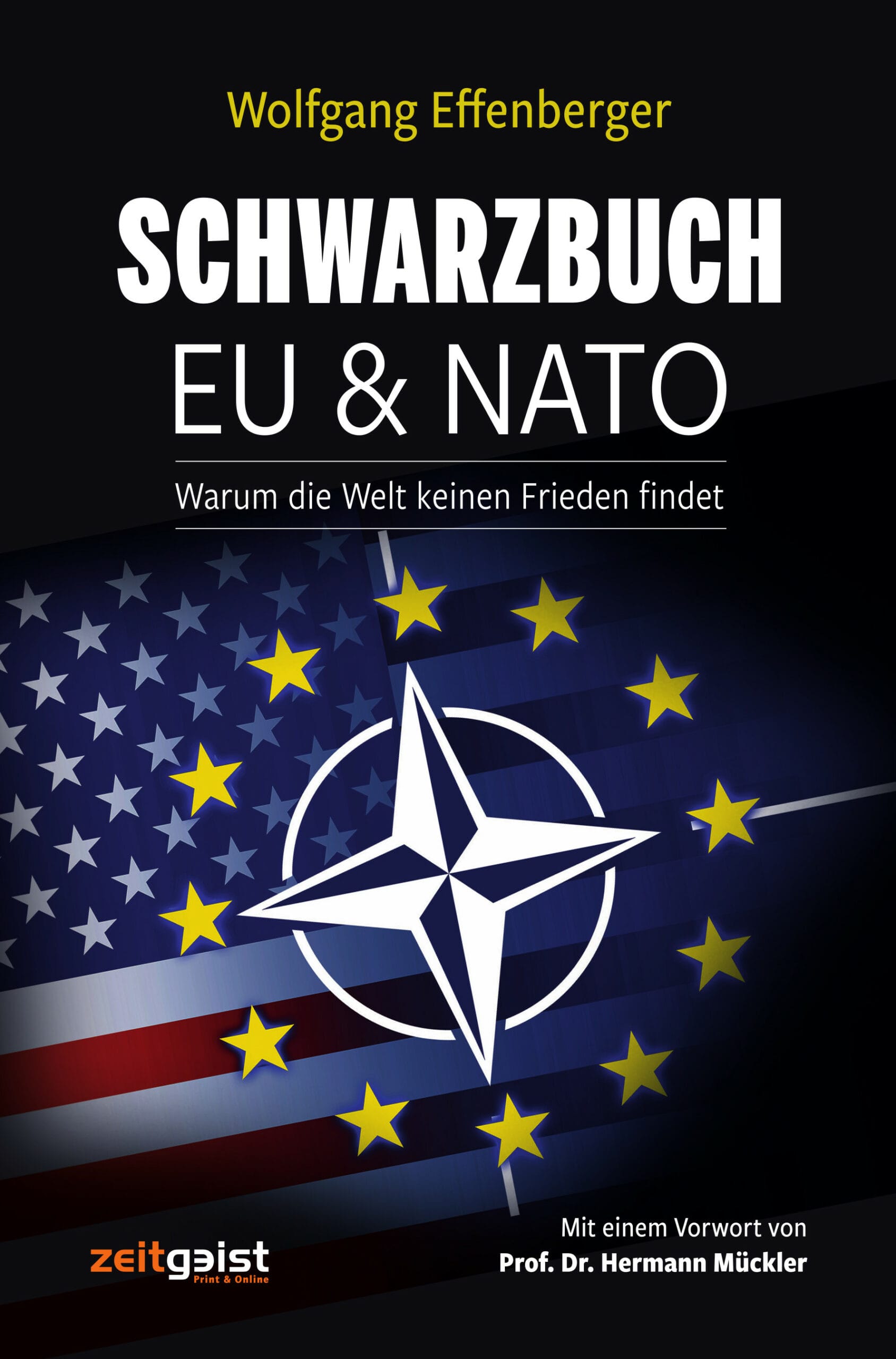
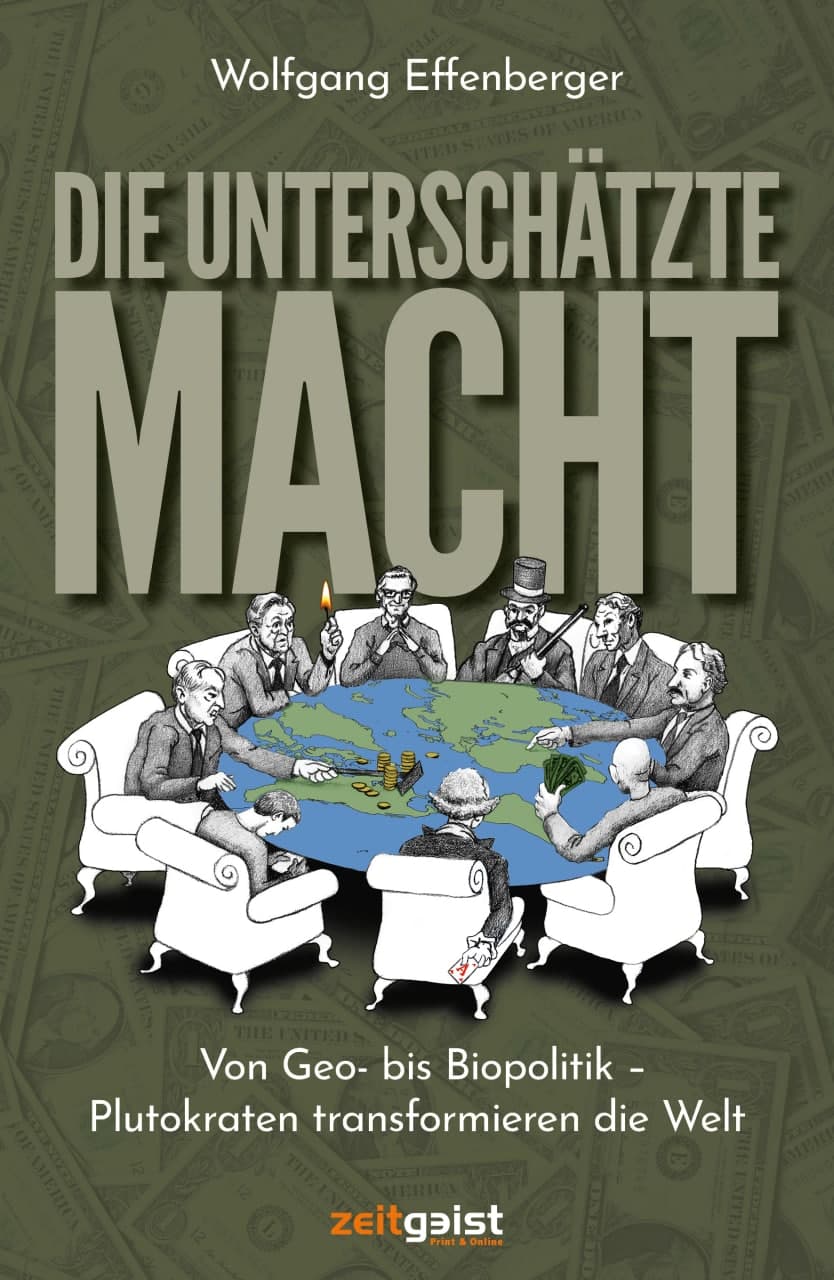

1)Howard Fremeth: H.G Wells, the World State, and the Poltics of History unter https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/westernumirror/article/download/16070/12464/39518
2) Wolfgang Effenberger: Schwarzbuch EU & NATO Warum die Welt keinen Frieden findet. Höhr-Grenzhausen 2020, S. 92
3) Ebda.
4) https://www.academia.edu/99238517/HG_Wells_and_South_Africa
5) https://www.gutenberg.org/files/57481/57481-h/57481-h.htm
6) Wolfgang Effenberger: Schwarzbuch EU & NATO "Warum die Welt keinen Frieden findet". Höhr-Grenzhausen 2020, S. 36
7) Wolfgang Effenberger: Schwarzbuch EU & NATO "Warum die Welt keinen Frieden findet". Höhr-Grenzhausen 2020, S. 37
8) Robert Kurz: Schwarzbuch Kapitalismus Ein Abgesang auf die MarktwirtschaftMünchen 2002, S. 387
9) https://www.deutschlandmuseum.de/geschichte/deutscher-bund/
10) https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/revolution-von-1848-265/9892/scheitern-eines-traumes/
11) Hansard, Parliamentary Debates, Ser. III, Bd. cciv, February-March 1871, Rede vom 9. Februar 1871, S. 81-82; englischer Originaltext abgedruckt in William Flavelle Moneypenny und George Earle Buckle, The Life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield, neue bearb. Ausg. in 2 Bänden, Bd. 2, 1860-1881. London: John Murray, 1929, S. 473-74.
Quelle der deutschen Übersetzung: Gerhard A. Ritter, Hg., Das Deutsche Kaiserreich 1871-1914. Ein historisches Lesebuch, 5. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, S. 181.
https://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1849&language=german
12) Walther Maas: England, Deutschland, Europa... Zur Zusammenkunft in Chequers, 8. Juni 1931
13) Zitat von Bülow lautete im Original (aus einer Reichstagsrede vom 6. Dezember 1897)
14) https://schicketanz.eu/2016-01-platz-an-der-sonne/
15) https://www.zeitklicks.de/zeitstrahl/1897/platz-an-der-sonne
17) Johannes Lepsius, u. a., Hg., Die Große Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. 40 Bände. Berlin, 1922-1927. 11. Bd. S. 31-32. Abgedruckt in Rüdiger vom Bruch und Björn Hofmeister, Hg., Kaiserreich und Erster Weltkrieg 1871-1918. Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, herausgegeben von Rainer A. Müller, Band 8. Stuttgart: P. Reclam, 2000, S. 271.
18) https://www.deutschlandfunk.de/um-kopf-und-kragen-100.html
19) Vgl. Wolfgang Effenberger: Geo-Imperialismus Die Zerstörung der Welt. Rottenburg 2016, Kapitel 4 S. 115-127
20) https://digital.ub.uni-paderborn.de/download/pdf/7650681.pdf
21) https://www.fzp-wohin.de/heimat1/heimat33.htm
22) Vgl. Wolfgang Effenberger: Geo-Imperialismus Die Zerstörung der Welt. Rottenburg 2016
23) Sidney Fay aus der Encyclopædia of the Social Sciences
24) W. W. Antonow in "Das Sowjetparadies. Querschnitt durch die russische Revolution", Berlin 1931, S. 56
25) Wolfgang Effenberger: Schwarzbuch EU & NATO "Warum die Welt keinen Frieden findet". Höhr-Grenzhausen 2020, S. 37
26) https://www.leopoldina.org/mitgliederverzeichnis/mitglieder/member/Member/show/thomas-henry-huxley/
27) https://www.historeo.de/datum/1884-gruendung-der-fabian-society
30) https://cdr.lib.unc.edu/downloads/xp68kg82b?locale=en
32) https://cdr.lib.unc.edu/downloads/xp68kg82b?locale=en
33) https://www.gutenberg.org/files/45368/45368-h/45368-h.htm
34) Wells, H.G .: Die Geschichte unserer Welt. Berlin/Wien/Leipzig 1948
35) https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/making-sense-of-the-war/
36) Effenberger 2020, S. 532
37) Ebda.
38) https://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=2297&language=german
39) https://teachjustnow.eu/wp-content/uploads/2024/08/GER-History-of-Propaganda-Timeline.pdf
40) https://oag.jp/img/images/publications/oag_notizen/Notizen1412-Saaler.pdf
42) https://www.liberationroute.com/de/stories/193/victorious-powers-in-berlin
43) https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/IzpB_358_Nachkriegsgeschichte_240402_Webversion.pdf
45) https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/IzpB_358_Nachkriegsgeschichte_240402_Webversion.pdf
46) https://de.wikipedia.org/wiki/Besatzungszone
47) Bundeszentrale für politische Bildung: Die Bedeutung der Besatzungszeit 1945-1949
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bildquelle: imagoDens / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut