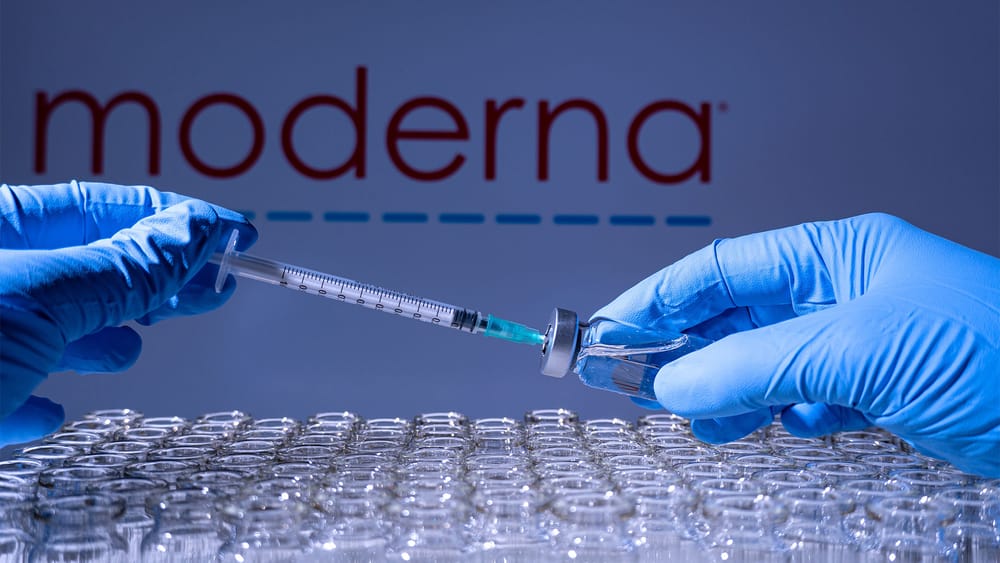Der Gipfel von Alaska ist vorbei. Er hat wenig Klarheit gebracht über den weiteren Verlauf des Krieges. Dennoch wird immer deutlicher, dass Trump von den Europäern und der Ukraine Opfer erwartet. Aber Standfestigkeit ist nicht seine Stärke. Gilt morgen noch, was heute galt?
Ein Meinungsbeitrag von Rüdiger Rauls.
Große Ankündigungen
Trump ist der Mann der großen Worte. Vom ersten Tag seiner zweiten Amtszeit an hielt er die Welt mit seinen täglich neuen Plänen und Vorhaben in Atem. Die bisherigen Ergebnisse sind dürftig und haben das Leben der wenigsten Amerikaner verbessert. Von den großen Umwälzungen, die beispielsweise sein Aufräumkommando DOGE in der staatlichen Verwaltung unter Leitung von Elon Musk hätten bringen sollen, ist keine Rede mehr. Mit Musk ist er inzwischen zerstritten, gegen dessen Maßnahmen sind zahllose Klagen anhängig. Nach den Statistiken und Zahlen wurde wenig damit erreicht.
Kanada ist bisher nicht der einundfünfzigste Staat der USA und auch Grönland ist immer noch nicht amerikanisch geworden. Der Panamakanal gehört noch immer zu Panama. Der Gazastreifen sieht nicht nach einer Riviera des Nahen Ostens aus. Er ist zerbombt und die Leiden der Bevölkerung sind unvorstellbar. Trump scheint das Interesse an diesem Krieg verloren zu haben, seit klar geworden ist, dass der Iran nicht so leicht mit ein paar amerikanischen Raketen zu beeindrucken ist. Sie reichten nicht aus, um dessen Atomprogramm zu stoppen. Nach den Einschlägen iranischer Raketen auf amerikanischen Stützpunkten im Nahen Osten endete umgehend Amerikas direkte Beteiligung.
Von da an war es auch mit den israelischen Raketenangriffen auf den Iran vorbei. Diese sind teuer, zumal wenn sie in den USA gekauft werden müssen. Zudem hatten die iranischen Gegenangriffe mehr Verwüstungen in Israel angerichtet, als man erwartet hatte. Tel Avivs viel gepriesene Raketenabwehr Iron Dome hatte viele nicht abfangen können. Ministerpräsident Netanjahu hatte wohl mehr von Trump erwartet als große Worte und nur symbolische Raketeneinsätze. Der Krieg im Nahen Osten geht weiter, aber ohne Trump. Trotz der Toten und Zerstörungen steht der Iran nach zwölf Tagen als Sieger da, den weder Israel noch die USA hatten bezwingen können.
Große Gesten
So schnell Trump die Migranten aus dem Süden als Kriminelle gebrandmarkt hatte, so schnell schwenkte er um, als „großartige Landwirte, Hoteliers und Freizeitanbieter“ ihm klar machten, nicht auf diese Arbeitskräfte verzichten zu können. Hatte er auf erstere vor nicht allzu langer Zeit noch Jagd machen lassen, so spricht er von einem Tag auf den anderen plötzlich von „guten, langjährigen Arbeitskräften“. Das war kein Sinneswandel. Es war vielmehr der Druck vonseiten einer wichtigen Unterstützergruppe, die ihn kleinlaut werden ließ. Fortan sollte die Einwanderungsbehörde ICE Razzien und Festnahmen in Landwirtschaft, Hotels und Restaurants weitgehend einstellen.
Wollte er vor seiner Wahl noch den Skandal um Epstein lückenlos aufklären und der Öffentlichkeit alle Unterlagen zu den Vorgängen zugänglich machen, so ist davon nun keine Rede mehr. Im Gegenteil beschimpft er sogar seine Anhänger, die ihn an seine Versprechen vor der Wahl erinnerten, als Fünfte Kolonne der Demokraten. Zur Ablenkung stiftete er schnell einen Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien, den bisher niemand auf der Rechnung gehabt hatte und der zudem nichts verbesserte, was nicht schon vereinbart war. Aber er schuf einen neuen Konflikt mit dem Iran.
Trump ist nicht standfest. Ihm fehlt politisches Bewusstsein. Er ist – anders als Putin oder Xi Jingping – ein Getriebener, getrieben von den Erwartungen, die er bei seinen Wählern und Anhänger genährt hatte, und seinen persönlichen und politischen Unzulänglichkeiten, diese Erwartungen zu erfüllen. Stattdessen liefert er große Gesten und noch größere Worte. Mit gereckter Faust fordert er seine Anhänger auf zu kämpfen. Aber wofür, wogegen oder gegen wen? Gegen das Establishment, zu dem er selbst gehört? Gegen einen Tiefen Staat, von dem niemand weiß, wer das sein soll?
Er gibt den Kämpfer für die Interessen der kleinen Leute, zu denen er selbst nicht gehört, die er aber zu verstehen vorgibt. Er spielt sich auf als Volkstribun, der aus der herrschenden Klasse kommt, aber für die beherrschte Klasse eintreten will. Vielleicht glaubt er selbst daran. Aber die beherrschte Klasse will Ergebnisse sehen, die ihr nützen. Ihnen liegt nichts an Friedensabkommen zwischen zwei Staaten, die die meisten von ihnen gar nicht kennen. Sie will die Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen, sinkende Preise, bessere Arbeitsplätze oder Arbeit überhaupt. Das aber gerade schafft Trump nicht.
Wenig Zählbares
Mit jedem neuen politischen Vorhaben platzen auch immer wieder Hoffnungen, die er im Wahlkampf geweckt hatte. Er schafft ständig neue Konflikte, um sich für deren Beilegung dann feiern zu lassen. Aber sie wären ohne ihn nicht entstanden wie die Überfälle seiner DOGE-Sturmabteilung, der Einsatz des Militärs in Los Angelos und nun in Washington, die Raketen auf den Iran, die Razzien auf Migranten, die Konflikte mit Universitäten, Richtern und dem Chef der Notenbank, Jerome Powell.
Mit jedem dieser Konflikte verprellt er einen Teil seiner Unterstützer und schafft sich stattdessen neue Feinde. Seine Zustimmung in der Gesellschaft sinkt. Hatte sie im November 2024 noch einen Höchststand von 50 Prozent erreicht, so ist sie in den wenigen Monaten seitdem beständig gesunken. Mitte August waren es nur noch 44 Prozent, der Tiefpunkt hatte Mitte Juli bei 40 Prozent (1) gelegen. Trotz der goldenen Zeiten, die Trump den amerikanischen Arbeitern versprochen hatte, geht die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze dramatisch zurück.
Das fällt nicht weiter auf, weil die Arbeitslosenstatistik konstant geblieben ist. Denn „gefeuert wird so wenig wie selten zuvor. Zugleich suchen [aber auch] weniger Menschen Arbeit.“(2). Die Unternehmen sind durch Trumps Sprunghaftigkeit verunsichert und halten sich mit Neueinstellungen und Investitionen zurück. Das führt dazu, dass „von Anfang Mai bis Ende Juli weniger als 100.000 Stellen geschaffen wurden – so wenig wie seit 2010 nicht mehr.“(3). Es gibt kaum Beschäftigungsgewinne, nicht einmal in der Industrie, die Trump mit seinen Zöllen und dem Investitions-Druck auf Unternehmen zu neuem Leben erwecken will.
Bisher sind die Prognosen vieler Experten von steigender Inflation durch steigende Zölle nicht in dem Maße eingetreten, wie vorausgesagt. Der Verbraucherpreisindex bewegte sich kaum im ersten Halbjahr und liegt weiterhin unter 3 Prozent. Das liegt zum einen daran, dass „Importe nur elf Prozent der amerikanischen Wirtschaft ausmachen.“(4). Zum anderen suchen viele Unternehmen nach Wegen, die Zolllasten nicht auf die Preise überzuwälzen, oder aber sie nehmen Abschläge bei den Gewinnen in Kauf. Das trifft besonders auf die Autofirmen zu. „Ford zahlte allein im zweiten Quartal 800 Millionen Dollar an Zöllen ...[und] für das Gesamtjahr erwartet der Konzern einen Ergebniseinbruch von drei Milliarden Dollar“(5). Ähnlich sieht es bei General Motors aus.
Wenig Erfolg
Trotz seine hyperaktiven Umtriebigkeit, kommen wenig Vorteile und noch weniger von Bestand dabei heraus. Dabei stehen mit den Handelskonflikten die größten Belastungen noch aus. Mit einigen Staaten konnten Rahmenvereinbarungen getroffen werden wie mit der Europäischen Union. Aber der dickste Brocken bleibt China, das nach Trumps großsprecherischen Drohungen kurzerhand die amerikanische Wirtschaft auf eine Diät an den lebenswichtigen Seltenen Erden setzte. Kleinlaut verlängert der Amerikaner immer wieder die Frist für das Inkrafttreten der neuen Zölle, die er gegenüber China verhängen will. Nach einem berauschenden Erfolg sieht das bisher nicht aus.
China zeigt sich von Trumps großen Worten unbeeindruckt, seine Wirtschaft wächst kräftig. Dagegen wird den USA bei jeder Verhandlungsrunde von neuem deutlich vorgeführt, wessen Abhängigkeit größer ist. All das entgeht natürlich auch nicht der amerikanischen Bevölkerung, so weit sie sich für diese Kräftemessen überhaupt interessiert. Auch sie erfährt, dass Trumps Plan nicht aufgeht, mit den Zöllen die Defizite der USA zu senken. Im Gegenteil: Inzwischen hat die Staatsverschuldung die Grenze von 37 Billionen (37.000 Milliarden) Dollar überschritten, und sie wächst immer schneller. Der amerikanische Rechnungshof, Joint Economic Committee, rechnet damit, dass „die Schulden in etwa 173 Tagen um eine weitere Billion Dollar steigen“ (6).
Wenigstens die Kosten des Ukrainekrieges konnte Trump abschütteln. Die Amerikaner haben sich aus der Finanzierung des Krieges zurückgezogen, stattdessen bitten sie die Europäer zur Kasse. Das entlastet den amerikanischen Haushalt und Steuerzahler, ist aber wenig aufsehenerregend im Verhältnis zu seinem vorlauten Getöse, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Aber daran wird er gemessen, und darin offenbaren sich seine persönliche Unzulänglichkeit und politisches Unvermögen.
Die großen Macher wie Trump machen in erster Linie große Versprechungen. Dabei treffen sie in den westlichen Gesellschaften auf weitgehend unpolitische Bevölkerungen, die sich nach großen Machern sehnen. Diese scheitern nicht an ihrem guten Willen, sondern an ihrer Unfähigkeit, die wirklichen Verhältnisse zu erkennen oder wollen sie nicht wahr haben. Sie halten ihre Ideen und Theorien für die Wirklichkeit. Zu Trumps Glück und zum Glück für die Welt hat er in den Verhandlungen über das Kriegsende, aber auch im Zollkrieg mit China auf der Gegenseite besonnene Verhandlungspartner, die sich nicht zu ähnlich großspurigem Auftreten hinreißen lassen.
Ein bisschen Frieden
Dass Trump über wenig politische Klarheit verfügt, macht ihn beeinflussbar. Telefoniert er mit Putin, dann neigt er dessen Sichtweisen zu. Spricht er mit den Europäern, droht er danach Putin mit schärfsten Sanktionen. Reden sie lange genug auf ihn ein, dann ist er von Putin sehr enttäuscht und bezeichnet als bullshit, was er Tage zuvor noch geschätzt hatte an dessen Sichtweisen. Das Treffen in Alaska zeugt erneut von Trumps Wirkungslosigkeit. Denn für den politischen Westen wurde wenig erreicht.
Der große Sieger dieses Treffens war Putin, wie viele Medien im Westen voller Neid und Verbitterung feststellten. Nicht nur, dass Trump dem steckbrieflich Gesuchten den roten Teppich ausrollte, Putin zeigte auch jenen die wahren Verhältnisse, die ihn immer wieder gerne als isoliert darstellten. Er kam nicht verängstigt, sondern unerschrocken direkt in die Höhle des Löwen, auf einen amerikanischen Militärstützpunkt. Was könnte gefährlicher sein für einen Gesuchten und was gleichzeitig die Veränderung der Lage deutlicher machen? Nicht Putin war außen vor, sondern seine Widersacher aus Europa. Als Konfliktparteien zweiten Grades informiert man sie nur darüber, was die Großen ohne sie ausgehandelt haben.
Sicherlich werden sie weiterhin versuchen, den wankelmütigen Trump wieder auf ihre Seite zu ziehen. Vielleicht wird es ihnen auch in Teilen wieder gelingen. Dennoch scheint sich die Lösung des Konflikts auf die Anerkennung der durch den Krieg neu geschaffenen Verhältnisse zuzubewegen. Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er ein Ende des Krieges will und dass dieses Ende auf Kosten der Ukraine und der Europäer geht. Nicht umsonst hatte er vor Ablauf seines Ultimatums seinen Unterhändler Witkoff nach Moskau geschickt, um das Ultimatum nicht erfüllen zu müssen.
Für Putin gibt es neben Russlands Sicherheitsinteressen auch noch einen anderen Grund, der in der westlichen Presse nicht erwähnt wurde, weil er nicht in das Bild des blutrünstigen Machtmenschen passt. Er will ein Ende des Krieges, weil er darin „eine Tragödie für uns und eine schreckliche Wunde“ (7) sieht. Denn es bekämpfen sich Brudervölker der einst gemeinsamen Sowjetunion. Aber er sagt auch, dass man zur Lösung dieses Konfliktes „alle legitimen Zwänge Russlands berücksichtigen und gleichzeitig die Sicherheit der Ukraine gewährleisten müsse“(8). Die Russen haben also nicht nur die eigene Sicherheit im Auge, sondern auch die der Ukraine. Hätte der politische Westen diese Haltung gegenüber Russlands Interessen an den Tag gelegt, wäre es nicht zu diesem Krieg gekommen.
Quellen und Anmerkungen
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse.
+++
(2, 3, 4, 5) Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 9.8.2025 „Zollangst und Rezessionsangst“
(7, 8) China daily vom 18.8.2025: Trump und Putin bezeichnen Gespräche als „konstruktiv“
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: US-Präsident Donald Trump
Bildquelle: Brian Jason / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut