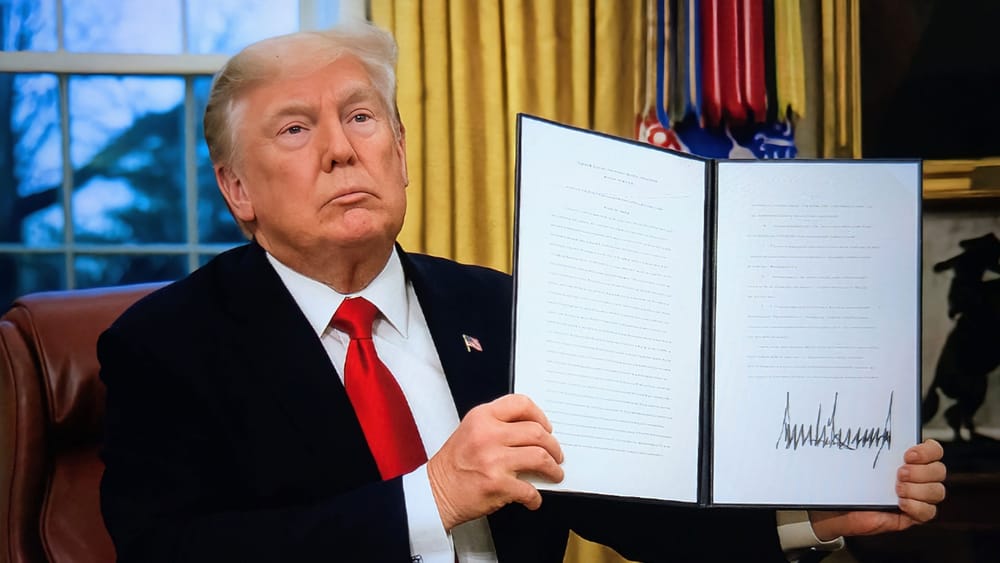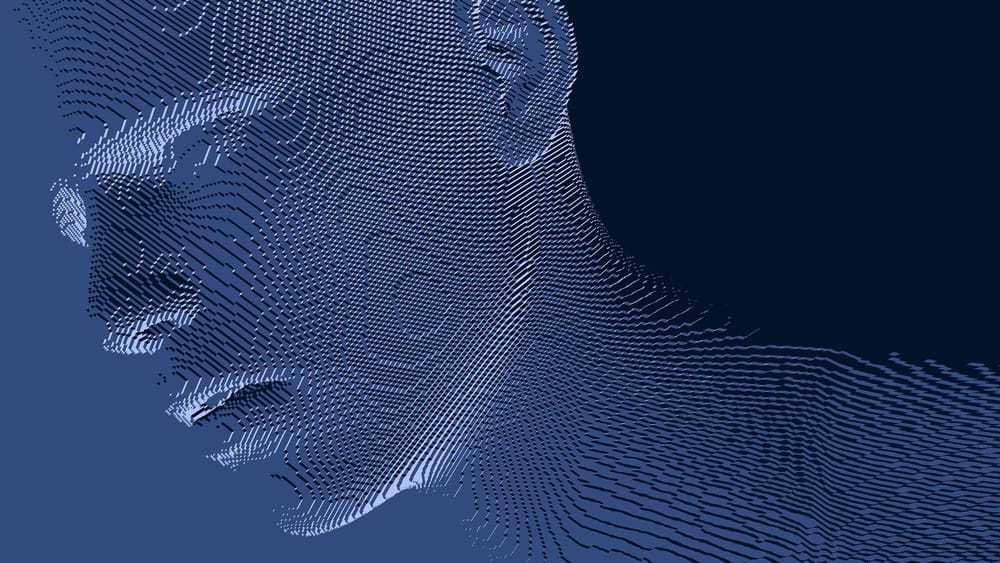Bisher konnte die Volksrepublik die Auswirkungen der Trump’schen Zölle sehr gut meistern. Exporte und Wirtschaftswachstum stiegen. Dennoch gibt es auch hausgemachte Probleme wie die nachlassende Ertragskraft der chinesischen Wirtschaft. Eine neue Politik soll abhelfen.
Ein Standpunkt von Rüdiger Rauls.
Wirtschaftliche Freiheit schafft Überkapazitäten
Chinas Unternehmen, ob private oder staatliche, können ihre wirtschaftliche Tätigkeit weitgehend frei von staatlichen Eingriffen ausüben. Das ist anders als westliche Medien immer wieder bemüht sind dazustellen. Größtenteils sind die Vorschriften und Regulierung durch den chinesischen Staat wesentlich geringer als im Westen. Im Gegensatz zu Brüssel schreibt keine Behörde vor, wie groß und krumm Gurken sein dürfen. Staat und Partei greifen erst ein, wenn das Handeln der Unternehmen zu Entwicklungen führt, die nicht im gesellschaftlichen Interesse sind.
Diese Eingriffe werden oftmals in westlichen Medien zu Skandalen aufgebauscht, ohne die Überlegungen darzustellen, die zu diesen Entscheidungen führten. Als der große chinesische Immobilienentwickler Evergrande strauchelte, war sofort die Rede von verfehlter Wirtschaftspolitik. Die Partei hatte den Zugang zu weiteren Krediten verbaut. Die Partei war nach den Worten von Xi Jingping der Meinung:
„Häuser sind zum Wohnen da, nicht zur Spekulation“ (1).
Das bedeutet aber nicht, dass westliche Kritik immer nur auf Missgunst zurückzuführen ist. China ist sich über die Schwächen der eigenen Wirtschaft weitgehend im Klaren. Die überschüssigen Produktionskapazitäten im eigenen Land beeinträchtigen die Ertragskraft der Wirtschaft. Man weiß auch, dass dafür nicht alleine die amerikanische Zollpolitik verantwortlich ist. Sie sind aber auch nicht das Ergebnis einer von der Partei diktierten Wirtschaftspolitik, deren Ziel es sein soll, westliche Unternehmen auf dem Weltmarkt auszustechen.
Vielmehr ist die Entstehung der Überkapazitäten gerade weitgehend auf die freie unternehmerische Betätigung der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen. Das enorme Wachstum aufstrebender Industrien mit ihren fortschrittlichen Technologien bescherten den Städten, in denen sie angesiedelt waren, willkommene Einnahmen. Andere Städte oder Regionen zogen rasch nach und förderten den Aufbau jener erfolgreichen Industrien in ihrem Zuständigkeitsbereich.
„Der wiederholte Bau ähnlicher Industrieparks hat zu einer enormen Produktionsmenge und schließlich zu Überkapazitäten geführt“(2).
Von staatlicher Gängelung kann da keine Rede sein.
So lange der Weltmarkt für Solarpaneele beispielsweise wuchs, wuchsen auch Produktionsanlagen in China. In etlichen Städten entstanden ganze Zentren für Solartechnik. In anderen wurde die Autoproduktion, in den Hafenstädten der Schiffsbau massiv entwickelt oder unterstützt. Dabei handelt es sich um nichts anderes als um Standortentwicklung, so wie in Magdeburg die Ansiedlung von Intel oder in Schleswig-Holstein der Bau einer Batteriefabrik von Northvolt mit Milliarden an Zuschüssen, Subventionen und Bürgschaften gefördert wurde. Man erhoffte sich davon Wachstum an Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und Wirtschaftskraft, genau so wie in China auch.
Nachlassende Ertragskraft
Im Jahre 2014 war in China die Initiative „Made in China 2025“ als Plan für die eigene Wirtschaftsentwicklung ausgegeben worden. Es sollte mehr produziert und der Inlandsmarkt verstärkt mit chinesischen Produkten versorgt werden. China wollte nicht mehr nur Werkbank der Welt für billige Waren sein, sondern unabhängiger von westlichen Technologien werden und technologisch in die Weltspitze aufsteigen.
Das ist in vielen Bereichen gelungen, und dort, wo man am Weltmarkt erfolgreich war, fanden sich viele Nachahmer in China, die auf diesen Zug aufspringen wollten. Derzeit erlebt das Land eine Gründerwelle bei den Herstellern von Elektroautos. Mehr als hundert Unternehmen bieten ihre Fahrzeuge an. Viele von ihnen kämpfen ums Überleben, unterbieten sich in Rabattschlachten und werfen ihre Modelle mit Verlusten auf den Markt. Ähnliche Verhältnisse herrschen auch auf anderen Märkten wie dem Bereich Solartechnik, aber auch den großen E-Commerce-Plattformen.
Das wirkt sich aus auf die Ertragskraft der Unternehmen, sie erwirtschaften weniger Gewinn. Aufgrund der fallenden Preise für Industriegüter „sanken die Gewinne mittlerer und großer Industrieunternehmen im Mai [2025] im Jahresvergleich um 9,1 Prozent – der niedrigste Stand seit November letzten Jahres“(3). Damit waren deren Gewinne in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 1,1 Prozent niedriger als im Vorjahr.
Im gesamten Jahr 2024 hatte der Verbraucherpreisindex nur um 0,2 Prozent zugelegt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren waren die Erzeugerpreise negativ gewesen. Sinkende Gewinne in den Unternehmen bleiben nicht ohne Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Reichtum. Die Ertragskraft der chinesischen Wirtschaft lässt nach. So angenehm für den Verbraucher die sinkenden Preise sind, für die Wirtschaft insgesamt sind sie schädlich, wenn sie Ergebnis einer nachlassende Produktivität sind.
Diese Preisentwicklung ist vordergründig auf eine mangelnde Nachfrage zurückzuführen beziehungsweise auf eine Nachfrage, die niedriger ist als die Produktionskapazitäten.
Die chinesische Bevölkerung ist nicht arm, sie verfügt mit etwa 42,49 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) über eine der höchsten Sparquoten der Welt. Der weltweite Durchschnitt lag 2023 bei circa 23,02 %. Die Kaufzurückhaltung ist also nicht auf mangelndes Einkommen zurückzuführen. Vielmehr bedeutet sie, dass auf dem derzeitigen Preisniveau die Bedürfnisse der chinesischen Bevölkerung weitgehend gedeckt sind. Es bestehen keine weiteren Kaufanreize.
Verbesserung des Lebensstandards
Damit weiteres Kaufinteresse entsteht, müssten die Preise sinken. Das aber will man gerade verhindern, würde es doch die Ertragskraft der Unternehmen noch weiter belasten. Statt schädlichen Preisverfall zugunsten von Konsumwachstum zuzulassen, senkte der Staat die Preise künstlich, indem er Käufe bezuschusste. Die chinesische Regierung legte ein Programm mit bisher 300 Milliarden Yuan (rund 41,6 Milliarden US-Dollar) zur Förderung des Konsums auf. Der Kauf neuer Haushaltsartikel wie Kühlschränke, Waschmaschinen und ähnliches, was im Alltag der meisten Menschen gebraucht wird, wurde bezuschusst, wenn dafür alte Geräte entsorgt wurden.
Damit nicht genug wurde ein weiteres Programm aufgelegt, bei dem der Staat bei Konsumentenkrediten von über 50.000 Yuan (etwa 6.000 Euro) hinaus einen Teil der Zinskosten in Höhe von einem Prozentpunkt übernimmt. Das gilt für
„Autokauf, Altenpflege und Geburt, Bildung und Ausbildung, Kulturtourismus, Hausrenovierung, elektronische Produkte und Gesundheitswesen“(4).
Der Einzelhandelsumsatz bei Konsumgütern stieg daraufhin im ersten Halbjahr 2025 um 5 Prozent und der mit Dienstleistungen sogar um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Durch die Zuschüsse flossen Gelder in den Wirtschaftskreislauf, die sonst auf den Konten der Verbraucher zurückgehalten worden wären.
Ein Prozentpunkt hört sich nach wenig an. Aber man erwartet, dass die staatlichen Zuschüsse „Billionen Yuan an Verbraucherausgaben freisetzen“(5). Die Fördermaßnahmen sollten nicht nur die Situation der Unternehmen, sondern auch „den Lebensstandard verbessern“(6). Bemerkenswert ist hierbei besonders die Schwerpunktverlagerung der chinesischen Politik. Dienten frühere Subventionen in erster Linie Investitionen und der Ausweitung des Angebots, so geht es jetzt um die Hebung der Nachfrage und des Lebensstandards.
Den Markt entwickeln
Neben der finanziellen Förderung der Bürger zur Steigerung von Konsum und Lebensstandard sollen administrative und politische Entscheidungen die nachlassende Ertragskraft stoppen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vereinheitlichung des chinesischen Marktes. Er verfügt allein aufgrund seiner Größe über ein gewaltiges Wirtschaftspotenzial. Um dessen Vorteile zu heben, will die chinesische Führung
„den lokalen Protektionismus energisch abbauen, Marktmonopolisierungen umgehend verhindern und eindämmen sowie einen einheitlichen nationalen Markt erhalten und weiterentwickeln“ (7).
Mit lokalem Protektionismus sind die unterschiedlichen Verordnungen und Förderungen durch Gemeinden und Provinzen gemeint. Sie verursachen unnötige Kosten durch bürokratischen Aufwand und können zudem zu einer Benachteiligung von Unternehmen führen, die nicht zu diesem Verwaltungsbereich gehören. Im gesamten Land sollen mit gleichen Vorschriften und Maßnahmen gleiche Marktbedingungen gelten, um die Zersplitterung des Marktes zugunsten eines einheitlichen nationalen Marktes zu beseitigen.
Das größte Hindernis für eine positive Entwicklung der Unternehmenserträge liegt aber in der Konkurrenz der Unternehmen untereinander selbst. Sie liefern sich Rabattschlachten und versuchen durch unlauteren Wettbewerb, sich gegenseitig aus dem Markt zu drängen. Gegen diese Versuche von Monopolbildung will die politische Führung nun mit dem Mittel des Preisrechts energisch vorgehen, nachdem Appelle nicht gefruchtet haben. Dieses besteht in seiner derzeitigen Form seit 1998. Es wird den neuen wirtschaftlichen Entwicklungen nicht mehr gerecht.
Damals erfolgte die Preisgestaltung noch weitgehend durch die Entscheidung von Menschen. Inzwischen aber haben besonders bei den großen Unternehmen Algorithmen die Preisgestaltung übernommen. Die Überarbeitung des Preisrechts zielt nun darauf ab,
„den erbitterten Preiskrieg, die Diskriminierung durch Algorithmen und andere unfaire Marktpraktiken“(8)
zu unterbinden. Strengere und klarere Regeln gegen Kampfpreise sollen aufgestellt werden, um Verkäufe unter den Herstellungskosten zu unterbinden.
Die ausufernde Konkurrenz der e-Commerce-Plattformen soll eingeschränkt werden, die mit Kampfpreisen Wettbewerber vom Markt verdrängen wollen. Die Plattformen sollen künftig, „andere Betreiber nicht zwingen dürfen, Preise unter dem Selbstkostenpreis anzubieten“(9). Diese wirtschaftliche Entwicklung, in China als Involution bezeichnet, schadet nicht nur den Unternehmen selbst sondern auch dem Einkommenszuwachs der Haushalte, insbesondere bei Gering- und Mittelverdienern. Denn sie schmälert die Gewinnmargen, treibt Unternehmen in die Verlustzone und gefährdet damit Arbeitsplätze.
All das sind Maßnahmen, die auch Bürger und Regierungen im politischen Westen gutheißen würden – in der Theorie. Doch solche Eingriffe in die private Verfügungsgewalt über Produktionsmittel und in die Preisgestaltung der Wirtschaft sind in der im Westen herrschenden Gesellschaftsordnung unzulässig, selbst wenn die wirtschaftliche Stabilität bedroht ist. Der Staat kann nur die Schäden der Ordnung ausbügeln. Sie im Vorhinein zu vermeiden, ist für ihn weitgehend ausgeschlossen, soweit solche Eingriffe nicht mit Zustimmung der Unternehmen erfolgen. Darin drückt sich die Herrschaft der herrschenden Klasse aus.
Neue Regeln
Auch die chinesische Regierung setzt ihre Maßnahmen nicht diktatorisch durch. Das ist auch nicht mehr nötig, weil Kapitalbesitzer und Unternehmer nicht mehr die herrschende Klasse darstellen. Sie beugen sich den Entscheidungen von Partei und Regierung. Zudem haben sie auch die Erfahrung gemacht, dass sie damit ganz gut fahren. Wie auch der Adel sich der Herrschaft des siegreichen Bürgertums unterworfen hatte und damit letztlich nicht schlecht lebte, so hat sich auch in China das Kapital der Herrschaft eines Staates unterworfen, der von einer kommunistischen Partei geleitet wird, und lebt damit nicht schlecht.
Das aber genügt nicht, um das Problem der Überkapazitäten zu lösen. In ihnen haben unlauterer Wettbewerb, Versuche der Monopolbildung und die ruinösen Preiskämpfe ihren Ursprung. Es müssen praktische Lösungen gefunden werden. Eine besteht darin, dass die Preisüberwachung der Nationalen Reform Kommission (NDRC) festgelegt hat, dass Betreiber von Plattformen
„keine Daten, Algorithmen, Technologien oder Regeln verwenden dürfen, um unfaire Preisgestaltung zu betreiben“. (10)
Chinas Führung verstärkt die Kontrolle über den Wettbewerb und ordnet ihn neu. Sie strebt die Schaffung eines Marktes an, der Qualität und Innovation belohnt und gleichzeitig eine gesündere und nachhaltigere industrielle Entwicklung fördert. Es geht nicht nur darum, den Verdrängungswettbewerb zu bekämpfen, sondern statt dessen Unternehmen bei der Verbesserung der Produktqualität anzuleiten. Denn es ist nichts damit gewonnen, wenn die Preise stabil bleiben auf Kosten der Produktqualität. Es geht um eine umfassende Modernisierung der Marktregulierung in China.
Beides, Steigerung der Produktqualität bei gleichzeitiger Erhöhung der Ertragskraft, soll erreicht werden durch den geordneten Abbau veralteter Produktionskapazitäten. Unter Verwendung künstlicher Intelligenz sollen modernere Anlagen aufgebaut werden, die die Effizient der Produktion steigern und damit den Ertrag. Ziel ist die Förderung von qualitativ hochwertigem Wachstum. Das ist der neue Entwicklungsplan für die chinesische Wirtschaft. Das verstehen die Chinesen als sozialistische Modernisierung.
Quellen und Anmerkungen
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Houses_are_for_living%2C_not_for_speculation?utm_source=chatgpt.com
(8, 9, 10) Chinanews (ecsn) vom 1.9.2025: Überarbeitung des Preisrechts zur Gewährleistung fairen Wettbewerbs)
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse.
+++
Bild: Geschäftiger Hafen mit großen Frachtschiffen, der Chinas starke Handelsaktivitäten symbolisiert. Im Hintergrund steht eine moderne Skyline mit Wolkenkratzern
Bildquelle: Shutterstock AI / Shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut