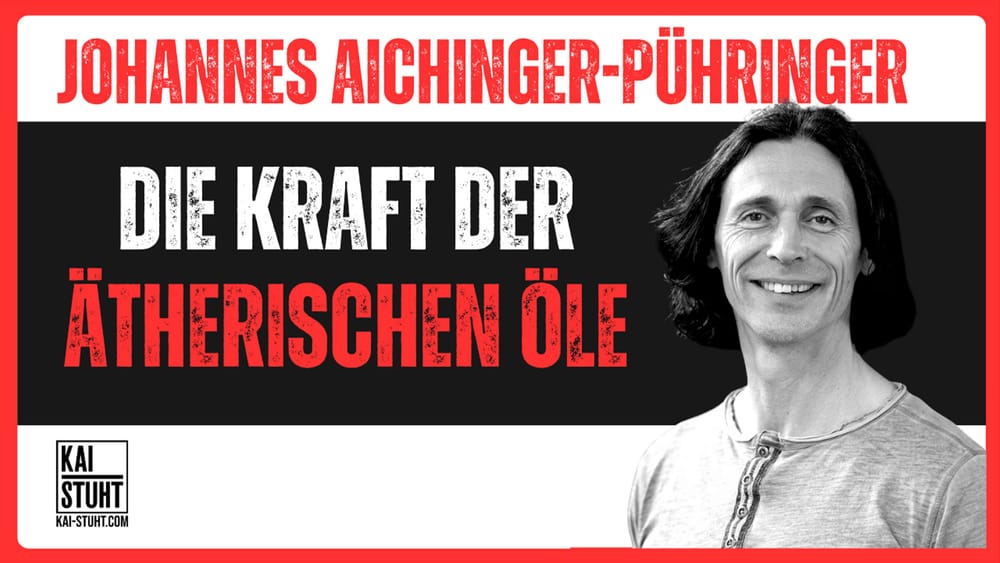Zum Kinostart von „The long Walk“
“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Deklassierte gegeneinander hetzen: Diesen Spaß gönnten sich schon römische Caesaren. Man trainierte Sklaven zu Gladiatoren, ließ sie aufeinander los. Dem Gewinner winkte sozialer Aufstieg. Und der Verlierer? Über dessen Schicksal entschied das Volk. In den Zuschauerrängen drängten sich nämlich Bürger aus der Unterschicht, ihrerseits entrechtet, mehr vegetierend als existierend. Aber in solchen Momenten genossen sie puren Machtrausch. Ihr Daumen, rauf oder runter, entschied über Leben und Tod. Eine kleine Entschädigung für lethargischen Alltag. Und das Beste: Ihre Wut wurde kanalisiert. Weg von den Herrschenden, den Verursachern. Berühmte Formel für diese Strategie: Brot und Spiele. Brot für den Körper, Arena-Spiele für die Psyche.
Zweitausend Jahre später. Berlin. Wieder lassen Machthaber die Bürger tiefe Ohnmacht spüren. Lassen sie das Prekariat, die modernen Plebs um ausreichende Versorgung bangen. Um deren Wut zu kanalisieren, hetzen sie gegen Arbeitslose, gegen Bürgergeldbezieher. Wie Sklaven werden die verbal entmenschlicht, zu „Schmarotzern“ degradiert. Solche Existenzen könne die Gesellschaft sich „nicht länger leisten“. Medien verbreiten Geschichten von raffinierten Sozialbetrügern. Propaganda-Botschaft: So sind sie alle! Die sollen arbeiten. Senkt ihren minimalen Lebensstandard ins Unerträgliche. Daumen runter! So errichten die Medien eine virtuelle Arena.
Hier setzte Stephen Kings Roman „The long Walk“ ein. Thema: Ein modernes Gladiatoren-Spiel. Mancher mag sich wundern: Der US-Gänsehautspezialist schreibt über Ausbeutung, über Klassendifferenz? Ja, gerade er. Schließlich besitzt der Star-Autor feine Antennen für alles, was Angst erzeugt. Und was fürchten Durchschnittsbürger mehr als soziale Abstürze? Hinab zum „White Trash“, ein Wohnwagen als neue Adresse - plus Alkohol als Grundnahrung? Der Unterschied zwischen existenziellem und sozialem Horror: Letzterer ist kein unabwendbares Schicksal. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Aber soziale Abstürze? Die könnte eine Gesellschaft verhindern. Abfedern. Die Stolpernden auffangen. Aber die US-Politik tut es nicht. Und dagegen empört sich King.
Der Star-Autor besitzt etwa 500 Millionen Dollar. Davon spendet er jährlich hohe Beträge: Beispielsweise 4 Millionen Dollar an Bibliotheken und örtliche Feuerwehren, die lebensrettende Ausrüstung benötigen. Aber genau im Akt des Spendens liegt für King das Problem. Die Verteilung von Reichtum sollte keine Gnade, keine Großzügigkeit, sondern Pflicht sein! Die Superreichen müssten krass besteuert werden, denn freiwillig gibt die Mehrzahl nichts her. In dem Essay „tax me, for f@%'s sake!", zu deutsch etwa: „Besteuert mich, verdammte Scheiße!“, kotzt sich King über Politiker aus, die ihn anflehen, soziale Themen zu meiden. Will er aber nicht. Denn die Mehrheit der Upper Class würde, O-Ton King, „lieber ihre Schwänze mit Feuerzeugbenzin übergießen, ein Streichholz anzünden und herumtanzen und ,Disco Inferno' singen, als noch einen Cent Steuern an Uncle Sugar (den Wohlfahrtsstaat, Anm. der Redaktion) zu zahlen."
Zurück zum Roman. King schrieb „The long Walk“ 1979 unter dem Pseudonym Richard Bachman. Grund für den Namenswechsel: Seine Verleger vertraten die Meinung, Autoren dürften nur einen Roman pro Jahr publizieren. Nicht mehr. Sonst sinke der Marktwert. Aber Kings Output lag wesentlich höher. Der reichte für zwei bis drei Romane pro Jahr. Also griff er zum Pseudonym.
Nie, so versichert der Autor, hätte er mit einer Kinoversion von „The long Walk“ gerechnet. Der Text sei „zu erbarmungslos, um verfilmt zu werden.“ Regisseur Francis Lawrence bewies nun das Gegenteil. Story gefällig? Die spielt in einem dystopischen Amerika. Es herrscht Diktatur. Die Wirtschaft liegt brach. Es grassiert Hungersnot. Wie im alten Rom versucht die Regierung, soziale Unruhen durch brutales Entertainment zu unterbinden. In diesem Falle: Durch den Todesmarsch. Auf den ist die Regierung mächtig stolz: „Wir haben diesen Marsch eingeführt, um die gesamte Menschheit zu inspirieren.“ Hundert Jugendliche nehmen teil. Allesamt Vertreter der Unterschichten. Der Wettbewerb besteht aus einem tödlichen Marsch quer durchs Land. Begleitet von Panzern und Soldaten. Wer schlappmacht? - Wird erschossen. Wer langsamer läuft als drei Meilen pro Stunde? - Wird erschossen. Das Ziel des Marsches?- Gibt es nicht. Er dauert so lange, bis nur noch einer übrig ist. Dem Überlebenden winkt eine Prämie. Ein alter Major (gespielt von Mark Hamill, dem Luke Skywalker der „Star Wars“-Filme) bezeichnet den Marsch als „Chance“. Außerdem habe er pädagogischen Nutzen: Das Publikum lerne, dass nur äußerste Anstrengung zu Wohlstand führe.
Zu Beginn zeigt der Film gutgelaunte Teilnehmer. Jeder hält sich für den kommenden Sieger. Ein Optimismus, der sich für neunundneunzig der hundert Teilnehmer als falsch erweist. Langsam sinkt die Stimmung. Dann die ersten Opfer: Einer verletzt sich am Fuß, humpelt. Fällt zu Boden. Countdown läuft. Bei drei muss er aufstehen. Der Gestürzte hält sich die Ohren zu. Schuss! Mit jedem Tag, jeder Stunde, jeder Meile dezimieren sich die Teilnehmer. Ihre Körper kollabieren: Ein epileptischer Anfall – Schuss! Ständiger Durchfall – Schuss! Ein Fluchtversuch – Schuss. Bittere Ironie: Nur Selbstmord schützt vor den uniformierten Killern.
Regisseur Francis Lawrence, gebürtiger Österreicher, ist bei diesem Thema kein Neuling. Auf sein Konto gehen bereits vier Folgen der „Tribute von Panem“-Reihe. Ebenfalls eine Dystopie, in der junge Menschen sich gegenseitig abschlachten. Als verschärfte Casting-Show zum Vergnügen der Massen. Wer glaubt, solch archaisches Entertainment sei in der Moderne kaum mehr möglich, der sollte sich erinnern: Ein ähnliches Rattenrennen wie „The long Walk“ avancierte erst vor hundert Jahren zum Publikums-Renner. In den 1920ern und frühen 30ern, als die Weltwirtschaftskrise unsagbares Elend hervorrief.
Damals meldeten sich junge Paare zu den „Marathon-Tänzen“. Durchtanzen bis zum Kollaps. Und wie beim Todesmarsch: Sieger wurde, wer am längsten durchhielt. Dem Paar winkten 5000 Dollar. Damals eine astronomische Summe. Ein Marathon konnte bis zu zwei Monate dauern. Bald lagen die Paare sich halb bewusstlos in den Armen. Kollabierte einer, versuchte der Partner ihn weiter zu schleifen. Wein- und Schreikrämpfe, seelische Zusammenbrüche wurden nach 200 Stunden Dauertanz zur Routine. Selbst Liebespaare entwickelten Ekel voreinander.
Wie gesagt: Diese Horrorshows waren bis 1935 beliebtes Massen-Entertainment. Auch Promis saßen im Publikum. Der Schriftsteller Horace McCoy schrieb darüber den Roman „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“, der 1969 ins Kino kam. Wie bei Stephen King sollten US-Marathon-Tänze auch andere Länder „inspirieren“. So exportierte die Ross Amusement Company seine Folter-Shows nach Deutschland. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch beschrieb sie in dem Kurzessay „Wut und Lachlust“ (1928): Sogar das Publikum wurde eingespannt. Wer ein Tanzpaar verpetzte, weil es die 15minütige Ruhepause heimlich überzog, wurde mit 1000 Reichsmark belohnt! - Philanthrop zu sein ist manchmal gar nicht so einfach.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bild: Filmplakat von" The long walk" im Doncaster Leisure Park, Doncaster, South Yorkshire, UK
Bildquelle: Steve Travelguide/ shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut