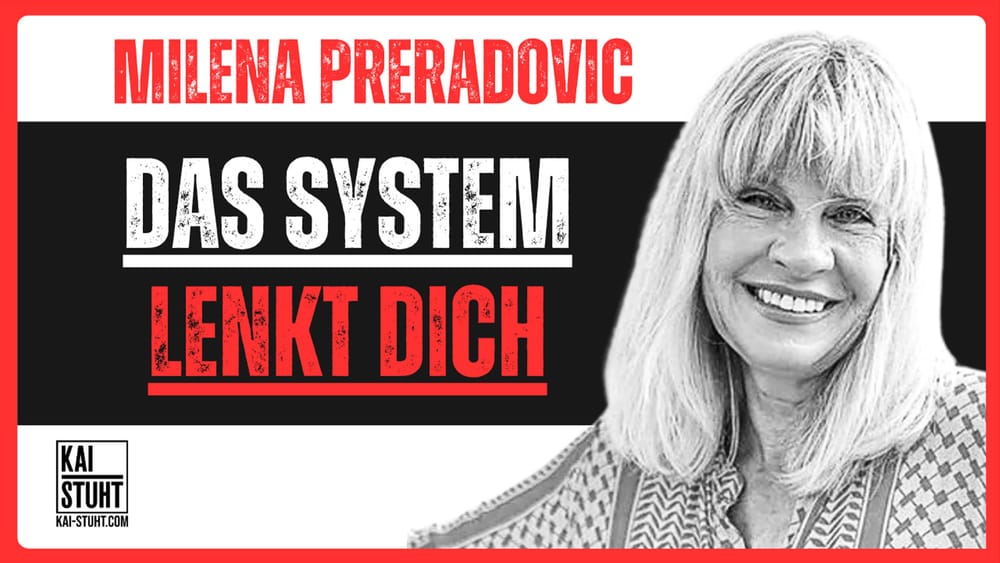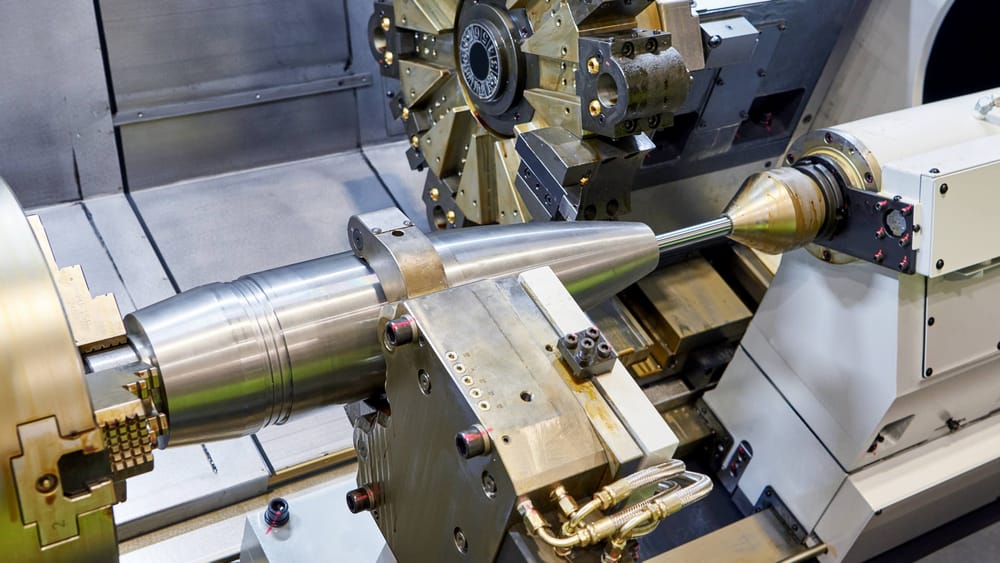Automatismen erdrücken zugleich Sozialstaat und Frieden
Wer heute in Deutschland Nachrichten verfolgt, stößt auf zwei scheinbar getrennte Schlagzeilen: In Washington durchsucht das FBI die Räume von John Bolton, Trumps einstigem Sicherheitsberater und Symbolfigur des amerikanischen Exzeptionalismus. In Berlin erklärt Friedrich Merz, Deutschland könne sich den Sozialstaat „in seiner heutigen Form“ nicht mehr leisten. Zwei Episoden – und doch ein gemeinsamer Nenner: Beide markieren den Vorrang von Militär über Gesellschaft, von Stärke über Ausgleich.
Ein Meinungsbeitrag von Sabiene Jahn.
Friedrich Merz erklärte jüngst, Deutschland könne sich den Sozialstaat „in seiner heutigen Form“ nicht mehr leisten. Es ist ein Satz, der aufhorchen lässt – nicht nur, weil er mitten in die Angstdebatten über Bürgergeld und Renten fällt, sondern weil er mehr verrät, als er sollte. Inmitten von leeren Staatskassen, eskalierenden Rüstungsausgaben und einer Politik, die Automatismen über Debatten stellt, entlarvt sich eine Wahrheit: Mittel, die in Schulen, Renten und Krankenhäuser fließen müssten, verschwinden in Aufrüstung, Auslandseinsätzen und dauerhaften Bündnisverpflichtungen.
Parallel in den USA: Die Razzia gegen John Bolton, Trumps ehemaligen Sicherheitsberater und Symbolfigur des Exzeptionalismus. Offiziell geht es um die unsachgemäße Lagerung geheimer Dokumente. Politisch aber ist der Zugriff ein Schlag gegen jene Linie, die Amerikas Ordnung immer durch Eskalation sichern wollte – koste es, was es wolle. Bolton steht für den Reflex, Sicherheit nie im Ausgleich, sondern nur im Druck zu suchen. Dass nun ausgerechnet er ins Fadenkreuz der Justiz gerät, markiert einen symbolischen Bruch. Und hier schließt sich der Kreis: Bolton in Washington, Merz in Berlin – zwei Gesichter derselben Logik. Der eine verkörpert die Weltmacht-Mission, der andere verkauft Sozialabbau als Notwendigkeit. Beide eint das Dogma, dass Stärke Vorrang vor Ausgleich habe.
Schatten der Geschichte
Es gibt Stimmen, die fragen, ob Deutschland mit dieser Politik nicht einer gefährlichen Logik folgt, die an die dunkelsten Kapitel seiner Vergangenheit erinnert. Von einem „Sturm auf Moskau“ ist bereits die Rede, und die Versuchung ist groß, den Vergleich zu ziehen: Aufrüstung, Sozialabbau, Feindbilder – das alles kennen wir. Doch die nüchterne Analyse verlangt Präzision. Niemand behauptet, wir stünden vor einer Wiederkehr des Nationalsozialismus. Aber die Mechanismen, die wir beobachten, sind frappierend ähnlich: ein Vorrang für militärische Expansion, eine Verschiebung der Ressourcen weg vom Sozialstaat, eine Sprache der Härte, die Diplomatie als Schwäche brandmarkt.
In den USA ist diese Debatte seit Jahren im Gange. Autoren wie Chalmers Johnson oder Sheldon Wolin warnten schon früh, dass Amerikas Exzeptionalismus in eine Form „umgekehrten Totalitarismus“ kippen könne: nach außen missionarisch, nach innen ausgehöhlt. John Bolton war die Personifizierung dieser Haltung – der Glaube, dass Stärke und Eskalation das Einzige seien, was Ordnung schaffen könne. Heute übersetzt Friedrich Merz diese Linie nach Deutschland: Mit dem Satz, der Sozialstaat sei „nicht mehr finanzierbar“, benennt er, was längst Praxis ist – nämlich, dass gesellschaftliche Mittel nicht verschwinden, sondern in militärische Strukturen umgeleitet werden. Der Vergleich mit den 1930er Jahren darf nicht als plumpe Analogie missverstanden werden. Doch er zeigt: Auch damals wurden soziale Sicherungen geopfert, um die Kriegsmaschinerie zu füttern. Auch damals wurde eine vermeintliche „Notwendigkeit“ beschworen, die sich am Ende als Katastrophe entpuppte. Heute heißt das Vokabular anders – „Abschreckung“, „Bündnistreue“, „strategische Autonomie“ – doch die Dynamik ist die gleiche: Krieg wird als Sicherheit verkauft, während das Soziale systematisch ausgehöhlt wird.
Das Tragische ist, die meisten Bürger ahnen es noch nicht. Sie hoffen, dass Politik am Ende Vernunft findet, dass Diplomatie und Ausgleich zurückkehren. Doch der Moment, in dem wir klar benennen müssen, was geschieht, ist jetzt. Denn wenn Automatismen erst einmal in Haushalten, Fabriken und Verträgen festgeschrieben sind, ist der Korrekturradius minimal. Dann bleibt nur noch das Durchhalten auf einem Kurs, der Frieden verspricht und Krieg produziert.
Eine Frage nationaler Notwendigkeit
Wir stehen nicht mehr an einem Scheideweg, den manch ein einer hoffnungsvoll und vorsichtig beschreibt. Das klingt dramatisch, aber es würde die Realität verkennen. Deutschland hat den Abzweig längst genommen: Milliarden sind in EU-Fazilitäten gebunden, Rüstungsfabriken entstehen, NATO-Mandate werden routiniert verlängert. Merz’ Satz klingt wie nüchterne Haushaltsrhetorik, Merz sprach jedoch eine entscheidende Wegmarke offen aus. Er macht sichtbar, was andere kaschierten, der Sozialstaat ist zur Kriegsreserve erklärt. Schulen, Renten, Krankenhäuser werden nicht geschwächt, weil „kein Geld da ist“, sondern weil Ressourcen systematisch in militärische Strukturen umgeleitet werden. Doch genau hier beginnt auch die politische Verantwortung. Ein Kurswechsel ist möglich, aber er ist teuer, unbequem und konfliktträchtig. Teuer, weil Verträge mit der Rüstungsindustrie gekündigt und Mittel neu priorisiert werden müssten. Unbequem, weil der Bundestag Mehrheiten finden und gegenüber Brüssel wie Washington erklären müsste, warum Deutschland nicht länger den Automatismus mitträgt. Konfliktträchtig, weil Partner massiven Druck ausüben würden. Aber: Es wäre machbar.
Das hat seine Spiegelung in den USA. John Bolton steht dort für das Dogma des Exzeptionalismus – die Überzeugung, dass Amerika seine Ordnung nur durch militärische Stärke behaupten kann. Trumps transaktionale Außenpolitik, die auf Deals und Kosten-Nutzen-Kalkül setzt, steht diesem Denken diametral entgegen. Der Zugriff der Justiz auf Bolton ist deshalb mehr als ein Ermittlungsverfahren. Er ist Symbol für den Bruch zwischen zwei Weltbildern – kompromisslose Eskalation auf der einen Seite, pragmatischer Interessenausgleich auf der anderen. Europa folgt in erschreckender Parallelität. Macron verkauft „strategische Autonomie“ als Unabhängigkeit, meint aber Eskalationsbereitschaft. Starmer in London deklariert massive Rüstungsaufwüchse als Rückkehr zu Seriosität. Ursula von der Leyen tarnt die milliardenschweren Ukraine-Kreditlinien als technokratische Routine. Und Merz inszeniert sich als vorsichtiger Realist, während er faktisch dieselbe Logik stabilisiert: Sozialstaat und Diplomatie werden nachrangig, militärische Präsenz und Budgetbindungen alternativlos.
Nicht das Alter der Gesichter entscheidet, sondern ihre Denkmuster. Ob Friedrich Merz als Kanzler, Vize Lars Klingbeil, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als lautstarke Lobbyistin der Rüstungsindustrie, die Waffenexporte als moralische Pflicht verklärt oder die SPD. Sie ist kein Korrektiv mehr, sondern Mittäter. Sie hat die Infrastruktur gebaut, die Merz nun ausschlachtet. Sie alle stehen für dieselbe alte Struktur. Ein dramatischer Kurs, der den Sozialstaat zur Kriegsreserve macht.
Wandel kommt selten aus Apparaten
Damit bewegen sich sich im Widerspruch zu den Grundlagen deutscher Politik. Das Grundgesetz bindet Regierungshandeln an Frieden und das Wohl der Bevölkerung, der Zwei-plus-Vier-Vertrag verpflichtete Deutschland ausdrücklich, seine Sicherheitspolitik in Zurückhaltung und Ausgleich einzubetten. Wer diesen Rahmen ignoriert, betreibt nicht „Notwendigkeit“, sondern Vertragsbruch. Die Wende aber, die Deutschland jetzt braucht, darf nicht allein aus Ostdeutschland kommen, wo Skepsis gegenüber Krieg und NATO-Linien stärker ausgeprägt ist. Sie muss endlich auch in Westdeutschland ihren Anfang nehmen. Dort, wo Wohlstand aufgebaut und mit der Wiedervereinigung die Grundlage für ein friedliches Europa geschaffen wurde, muss die Gesellschaft begreifen, der Bruch mit dieser Politik ist keine regionale Option, sondern eine nationale Pflicht. Wer weiter in den Automatismen der alten Strukturen verharrt, bricht nicht nur mit Vernunft, sondern auch mit Recht.
Neue Köpfe sind nötig. Ob BSW um Sahra Wagenknecht, ob ostdeutsche AfD-Landesverbände, ob kleinere Gruppierungen jenseits des Parlaments – sie alle tragen zumindest den Anspruch, den Bruch zu wagen. Noch ist offen, ob sie die Kraft haben, die verkrusteten Strukturen tatsächlich aufzubrechen. Doch die historische Lektion lautet, der Wandel kommt selten aus den Apparaten selbst. Er wächst dort, wo Bürger neue Vertreter mandatieren, die nicht schon vorher in Thinktanks und Netzwerken des transatlantischen Militarismus verstrickt sind. Deutschland hat wenig Zeit. Je länger die Automatismen wirken, desto enger werden die Spielräume. Es braucht Politiker, die bereit sind, den Bruch zu vollziehen – notfalls auf Kosten ihrer Karriere.
Rechtfertigung von Ausgaben
Exzeptionalismus ist die Grundannahme, dass die USA nicht einfach ein Staat unter vielen sind, sondern eine einzigartige historische Mission besitzen. Daraus leitet sich die Haltung ab, dass Amerika besondere Rechte habe, auch zum Einsatz militärischer Gewalt, weil es sich selbst als Garant von Freiheit und Demokratie versteht. Bolton in den USA und Merz in Deutschland sind zwei Gesichter derselben Logik. Der eine verkörpert das Dogma Exzeptionalismus, der andere erklärt das Dogma mit dem Satz: Der Sozialstaat sei „nicht mehr finanzierbar“. Beide stehen für einen Kurs, der unter dem Label „Sicherheit“ firmiert.
Doch genau darin liegt die Täuschung: Es wird so getan, als sei Deutschland oder Europa akut bedroht. Wladimir Putin hat in zahlreichen Reden betont, dass Russland weder die Absicht noch die Kapazität hat, europäische Staaten anzugreifen. Wer dennoch ein permanentes Bedrohungsszenario konstruiert, betreibt keine nüchterne Lagebeschreibung, sondern eine politische Lüge – und zwar eine offene, bislang ungerügte. Sie dient dazu, Hass nicht nur gegen Russland als Staat zu schüren, sondern auch gegen Menschen, die mit diesem Raum kulturell, religiös oder historisch verbunden sind – orthodoxe Christen, Buddhisten, Muslime aus den postsowjetischen Republiken, Menschen aus gemischten Familien in der Ukraine und anderen Regionen. Diese Lüge zielt nicht auf reale Gefahren, sondern auf die Konstruktion eines Feindbildes, das möglichst viele Lebenswirklichkeiten in einen Verdacht einbezieht, und sie rechtfertigt Ausgaben, die nichts mit Sicherheit, sondern allein mit Eskalation zu tun haben.
Wer das nüchtern betrachtet, erkennt: Hinter der Maske von Verantwortung zeigt sich die Fratze des Krieges – und die schleichende Ausplünderung der Bürger dieses Staates. Es ist höchste Zeit, diesen Kurs zu stoppen. Jetzt.
Quellen und Anmerkungen
1.) https://www.axios.com/2025/08/22/john-bolton-national-security-adviser-trump-raid-fbi?
2.) https://www.politico.com/news/2025/08/24/jd-vance-john-bolton-00522188?
6.) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_237162.htm
7.) https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/en/
8.) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_1978
10.) https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Military_Assistance_Mission_in_support_of_Ukraine
11.) https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Friedensfazilität
+++
Wir danken der Autorin für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Bundeskanzler Friedrich Merz
Bildquelle: penofoto / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut