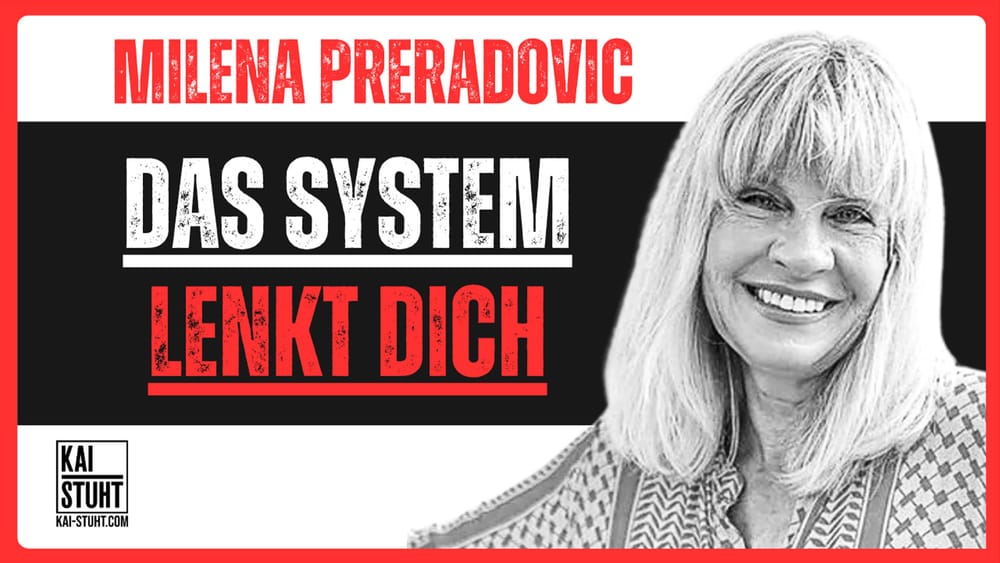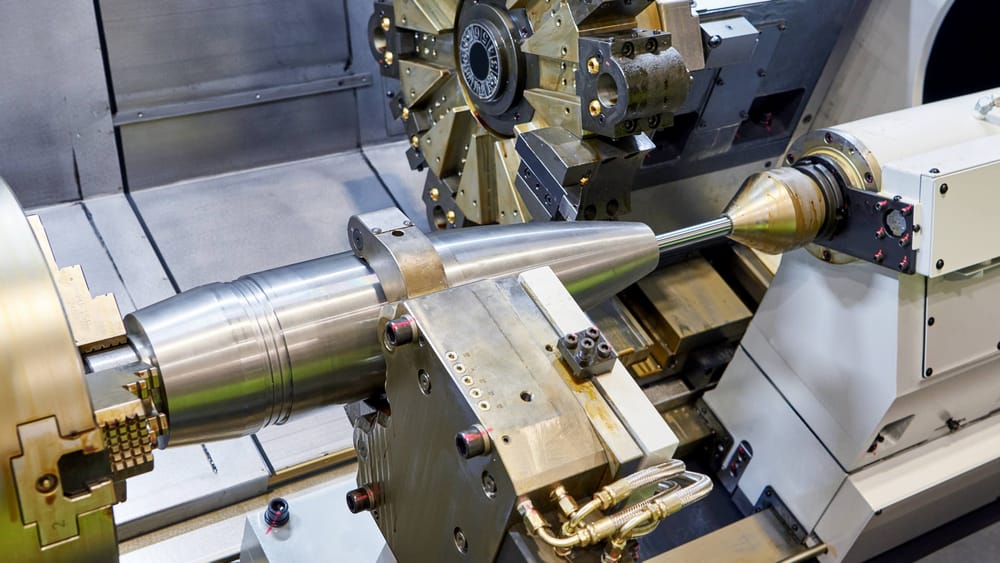“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Schon mal alte Fotos studiert? Mit „alt“ meine ich nicht Dias aus den Siebzigern, sondern Daguerreotypien aus dem 19. Jahrhundert. Nein, keine Landschaftsaufnahmen, sondern Ablichtungen von Personen. Was fällt da auf - abgesehen von Differenzen bei Kleidung und Frisur? Richtig: Die Fotografierten, sie lachen nicht. Sie schauen todernst. Ob Singles, Ehepaare oder ganze Familien. Manchmal wirkt der Blick sogar finster. In jedem Falle ist er frei von grundlosem Grinsen. Damit setzten frühe Fotografen die Porträtmalerei fort. Auch alte Ölschinken zeigten die Gesichter ernsthaft. Ebenso Büsten oder Statuen - egal, ob fiktiv oder nach Modell gefertigt. Selbst ein glückliches Gesicht, wie die Schaukelnde von Fragonard: Ihr Gesicht leuchtete, aber sie lachte nicht.
Eine der wenigen Ausnahmen im Bereich der Fotografie ist – ausgerechnet! - der pessimistische Philosoph Arthur Schopenhauer. Der hat auf einem Foto tatsächlich gelacht. Eine gigantische Leistung: Schließlich musste man zehn Minuten in absoluter Leichenstarre verharren, bis die Fotoplatte ausreichend belichtet war. Die Knipskiste war strenger als jeder Porträtmaler. Erst im 20. Jahrhundert wendete sich das Blatt. Und heute? Wer sich heutzutage fotografieren lässt, ist zum Grinsen, zum Lächeln verdonnert. Das lachende Gesicht; Es wird nicht bloß zugelassen, sondern verlangt: „Komm, sag mal Cheese“ – betteln Fotografen, wenn Kindern bei Familienaufnahmen nicht zum Lachen zumute ist. Eine Grinsverweigerung gilt vielerorts als unhöflich. Aber weshalb die krampfhafte Behauptung, dass es einem gut gehe? Egal, ob es zutrifft oder nicht: Woher diese Pflicht zum Glücklich sein?
Das späte zwanzigste und das frühe einundzwanzigste Jahrhundert boten dem westlichen Menschen nicht nur neue Freiheiten, sondern ebenso neue Zwänge plus eine - ebenso neuartige - Isolation. Ein Phänomen, das gerne als Atomisierung bezeichnet wird. Fern von Familie, Glaubenszirkel oder anderer Solidargemeinschaft muss jeder sein Leben als Einzelkämpfer meistern. Das setzt ein ständiges sich-bewerben voraus. Jede Bekanntschaft, jede Freundschaft ist fristlos kündbar. Jeder kann auf Facebook sofort geblockt werden. Folglich enthält jegliches Zusammentreffen eine Bewerbung um Verlängerung: „Schau her, ich bin die Zeit wert, die du für mich aufbringst.“
Freilich verlangt diese Feel Good-Kultur eine Einordnung in den Kontext ihrer Entstehung. Mitte der 1980e, im New Age Jahrzehnt, erlebte das „positive Denken“ seine erste Breitenwirkung. Die sollten nicht nur für verbesserte Stimmung sorgen und die Liebenswürdigkeit des Gutgelaunten steigern. Nein, dieses Denken sollte die Realität verändern. So lautet sein Anspruch. Dahinter steht die Phantasie, dass Gedanken eine Realität schaffen, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung beinhalten. Eine kindliche Allmachtsphantasie, eine späte Hommage ans magische Denken. Und genau darin liegt die größte Gefahr: Wenn nämlich positive Gedanken alles erreichbar macht, gilt jedes Elend selbstverschuldet. Genauer gesagt: Wenn sich bei dir nichts tut, liegt der Grund in Deiner mangelnden Bereitschaft zur Affirmation. So einfach ist das. Und leider wird es geglaubt. Diese magische Allmachtsphantasie ist im höchsten Maße destruktiv. Sie erlaubt die Verurteilung jeglichen Elends als selbstverschuldet. Sie führt zur Selbstabwertung, wenn das Gewünschte sich trotz positivem Denken nicht erfüllt. Für depressive Menschen ist es ohnehin eine mentale Selbstvergewaltigung.
Woher aber kam der New Age-Boom mit seiner toxischen Positivität? Nun, Mitte der Achtziger hatte die westliche Linke endgültig bankrott gemacht. Der Zeitgeist schwenkte langsam und dezent zum Wirtschaftsliberalismus. Leistung sollte sich wieder lohnen. Nicht mehr die Klassengesellschaft, sondern DU selber bist schuld, wenn DU kein Millionär wirst. Wer positiv denkt, wer den Erfolg gedanklich antizipiert, der bekommt ihn auch. Selbst im unfairsten Wirtschaftssystem kann jeder es schaffen. Es liegt wirklich nur an der Einstellung. Der Glaube versetzt Zwerge. - Von diesem Irrtum lebten und leben zahllose Motivations-Workshops. Die Wirtschaft setzte ganz auf den glücklichen Sklaven. Die Hochzeit zwischen befreitem Kapitalismus und positivem Selbstbeschiss war eine Win-Win-Situation. Tatsächlich ist der Kapitalismus auf Optimismus angewiesen. Pessimisten sind schlechte Zocker. Zudem ließ die zweite Hälfte der Achtziger eine bessere Zukunft erwarten: Gorbatschows Glasnost-Politik, die im Zusammenbruch der sozialistischen Staaten mündete, führte ein Ende des Kalten Krieges herbei. Intellektuelle wie Francis Fukuyama glaubten gar ans Ende der Geschichte. Die Love-Parade suggerierte auch das Finale innerpsychischer: Man demonstrierte für Frieden, Freude, Eierkuchen. Punk und No Future schienen passe. Nur in jenen Jahren konnte eine schwachsinnige Figur wie Forrest Gump zum gefeierten Kinohelden aufsteigen. Mancher bezeichnete die damalige Generation X bereits als „Spaßgesellschaft“. Aber es dauerte kein Jahrzehnt, bis deren Träume zerknallten. Der rheinische Kapitalismus verschwand. Auf dem globalen Markt starteten Rattenrennen, die ans 19. Jahrhundert erinnerten. Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder lief eine mediale Hetze gegen Sozialhilfeempfänger. Die Akzeptanz prekär bezahlter Arbeitsstellen wurde zur Pflicht. Sonst wurde die Stütze gekürzt.
All das heißt keinesfalls, dass das Konzept des positiven Denkens verschwunden wäre. Im Gegenteil. Es breitet sogar mit neuen Synonymen aus. Bis heute. Eines davon ist das Lucky Girl Syndrome. Das verpestet seit 2023 das soziale Netzwerk Tik Tok. Nur einige Filmemacher scheinen sich querzustellen. Seit Beginn des Milleniums taucht selbst der Populärfilm seine Heroen zunehmen ins Zwielicht - egal, ob es sich um reale oder fiktive Personen handelt. Makellos war gestern. Superhelden gönnen sich plötzlich finstere Seiten. Ein Meilenstein in dieser Richtung ist Christopher Nolans „THE DARK KNIGHT (2008). Bis dahin war der Joker eine Nebenfigur im Batman-Kosmos. Und obwohl er in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiert, konnte er erst im 21. Jahrhundert eine Solokarriere hinlegen.
Sein Debut in einem Batman-Comic feierte der Joker im Jahre 1940: Als harmloser Narr, der seine Opfer mit schlechten Witzen quält. In frühesten Batman-Filmen sucht man ihn vergebens. Erst in der englischen TV-Serie BATMAN feierte er sein Filmdebut, als einer von Batmans Erzfeinden. Erst 2008 avancierte er zum Antihelden. Und heldenhaft war er tatsächlich. Keinerlei Wunsch nach Macht oder Geld trieb ihn. Nur blanke Lust an der Zerstörung, geboren aus dem verzweifelten Wissen, dass alles Dasein vergeblich ist. Zitat: „Es gibt Menschen, die wollen die Welt einfach brennen sehen!“ so beschreibt Batman seinen Gegner. Das Joker-Lachen mutierte zum Höllengelächter, drang aus einem Mund, dessen Winkel wie verätzt wirken. Der zum Grinsen gezwungen wurde. Als seine Gang eine mehrfache Millionensumme gekapert hat, verbietet ihnen der Joker, sich an der Beute zu bereichern. Stattdessen sollen die Scheinchen verbrannt werden. Ein deutliches Zeichen, dass er ohne Gewinnorientierung agiert. Nicht mal seine Gang kann das nachvollziehen. Vielmehr trauern sie um die Lebensfreude, die dieses Geld ihnen beschert hätte. Mit THE DARK KNIGHT erreichte der Joker derart große Fankreise, dass 2019 ein eigener Film fällig wurde. Titel: JOKER. Darsteller: Joaquin Phoenix. Die Handlung spielt im Jahre 1981: Arthur Fleck ist ein psychisch kranker Party-Clown. Als der Staat ihm die Sozialhilfe streicht, das Geld für Psychopharmaka fehlt, rastet er völlig aus. Als Joker wütet er gegen Reiche und neoliberale Politiker. Ein Rächer der Enterbten, Armen und psychisch Zerrütteten. Dem prekären Scherzkeks reicht es: Es kommt der Tag, da will die Säge sägen.
Der JOKER-Film startete zum richtigen Zeitpunkt. Zum Ende der 2010er Jahre und dem Beginn der Zwanziger verlor die Idee der gutgelaunten Selbstbestimmung noch mehr Glaubwürdigkeit. Und es sollte noch dicker kommen. Kein Lockdown und keine Inflation ließen und lassen sich durch positives Denken ausbremsen. So erkannte der Psychologe Gerhard Vogel, Zitat:
„Die in der amerikanischen Psychologie verwurzelte Vorstellung, dass wir schon Veränderungen herbeiführen können, wenn wir nur guter Dinge bleiben, ist irreführend.“
In der Tat ist das positive Denken eine totale Kriegserklärung an den Realitätssinn. Wer alles Missgeschick zwanghaft ins Positive wendet, ruiniert die eigene Seele. Wie soll die Psyche den Schrecken je verarbeiten, wenn sie ihn nicht benennen darf?
Auch im Horrorfilm gefriert den Unholden der Mund zum ewigen Grinsen. 2004 startete eine Horror-Reihe mit dem Titel „Saw“: Der tödlich erkrankte Ingenieur John Kramer alias Jigsaw sperrt lebensmüde, depressive und suizidale Personen, die das Leben ablehnen, in seine Folterkammer. Mittels brutaler Schocktherapien und angedrohtem Tod will er ihnen positives Denken aufzwingen. Dabei trägt er eine Maske mit eingeritztem, starren Grinsen. Am Schuss jeder Folge, nach endloser Todesangst, physischem Schmerz und Zeugenschaft vom Tode anderer, zeigt die schwarze Pädagogik Erfolg. Die Überlebenden bejahen ihre Existenz. Optimismus als Resultat emotionaler Erpressung. Vor allem ein Berufstyp erfreut sich unter Horrorfans steigender Beliebtheit. Die Rede ist vom Clown. Schon der frühere Horrorfilmstar Lon Chaney erzählte, wie sehr das starre Grinsen eines Clowns ihn ängstige. Und über einen Clown, dem er nachts im Park begegne, könne er wahrlich nicht lachen. Zu den gegenwärtigen Star-Clowns im Horrorkino zählen: Pennywise aus Stephen Kings Roman IT. Der wurde vor sechs Jahren neu verfilmt. Der finstere Pennywise lockt Kinder in die Falle und lässt sie sterben. Hinter seiner Fassade verbirgt sich ein aggressives Alien.
Der fieseste aller Horror-Clowns ist jedoch der Terrifier. Der schlachtet ohne erkennbaren Grund, ohne vorhergehende Frustration, dafür aber auf brutalste Weise. Sein Name: „Art“, was auch „Kunst“ bedeutet. Damit signiert er Räume, in denen er ein Gemetzel veranstaltet hat. Und während er seine Opfer skapiert, verstümmelt, entweicht ihm ein Kichern. Seine schwarz-blutige Gebiss-Ruine wird erkennbar. Inzwischen zählt das Terrifier-Franchising bereits vier Teile. Der nächste ist bereits in Planung. Noch krasser gefälligst? Das bietet ein Film mit dem harmlosen Titel „ Smile“…
Etwas Unbekanntes, Fluchartiges löst bei seinen Opfern rasende Ängste aus. Dann, plötzlich überkommt sie ein starres Grinsen: Das Endstadium ist erreicht. Die Befallenen begehen Suizid. Beobachtet sie dabei ein Dritter, springt der Fluch auf ihn über. Wer sich retten will, muss einen anderen Menschen öffentlich ermorden. Dann springt der Fluch auf einen der Anwesenden über. In SMILE verformt das Grinsen sämtliche Gesichter zur Fratze. Dass jeder, den es befällt, kurz darauf Selbstmord begeht, zeigt wie viel Destruktivität sich hinter diesem Gesichtsausdruck verbirgt. Und ja - Das Ideal des dauerhaften Lächelns lösen nur Totenschädel ein.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bildquelle: Roman Samborskyi/ shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut