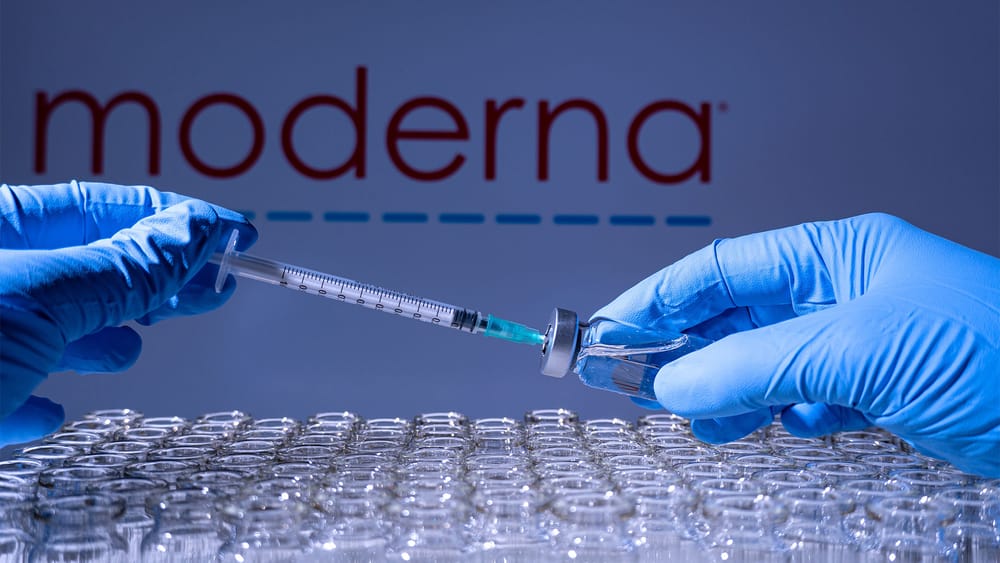Rainald Goetz kehrt als Bühnenautor zurück.
“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Im 21. Jahrhundert zeigt sich ein Phänomen, das historisch keinen Vorläufer hat, das vielleicht ohne Beispiel dasteht. Gemeint ist: Altwerden mit einer Jugendkultur. Mit einem Lebensstil also, den junge Menschen zur Abgrenzung gegen Ältere hervorbringen. Mit kulturellen Produkten, die subversive Vorbilder anbieten. Europa kennt solche Jugendkulturen seit dem 18. Jahrhundert. Man erinnere an die Sturm- und Drang-Bewegung. Auch der 24jährige Goethe lieferte mit den „Leiden des jungen Werther“ seinen Beitrag. Ein Rundumschlag, der ihn zum literarischen Popstar erhob. Gefeiert von jungen Lesern, die sich im Werther-Look kleideten und ihm sogar in den Suizid folgten. Allerdings fand Goethe solche Revolten-Poesie bald peinlich und gründete die „Weimarer Klassik“. Der Sturm- und Drang-Star wurde „erwachsen“.
Auch die Popkultur des 20. Jahrhunderts war auf Krawall gebürstet: Ob die Flapper der Zwanziger Jahre, die Rock’n Roller der Fünfziger oder die Beatniks der Sechziger: Stets wandten sich junge Künstler an ein ebenso junges Publikum. Mit dem Überschreiten der 30 wechselten die Adressaten meist ihre Vorlieben.
Inzwischen aber behalten Betagte zunehmend die Kultur ihrer Jugend bei. Etwa die Rolling Stones. Deren Bandmitglieder beweisen seit den Sixties, dass man auch mit Sex, Drugs and Rock n Roll das achtzigste Lebensjahr erreicht. Gut möglich, dass bald Altenpfleger die greisen Fans ins Konzert schieben. Um Emotionen, Erinnerungen zu tanken, auch wenn der Alltag längst in stillen Bahnen verläuft.
Aber Vorsicht: Fan-Kultur bis ins hohe Alter funktioniert nicht mit jeder Mucke, nicht mit jedem Genre. Ein Beispiel? Der Punk. Auch in aktueller Retro-Form bleibt er Jugendkultur. Musikgruppen wie die Sexpistols, Hans-A-Plast, Ton, Steine, Scherben oder Köterkacke artikulierten eine brachiale Wut, die keine Konkurrenz zulässt. Der Happy Hater kennt weder Schönheit noch Harmonie. Sein Nein brüllt er in maximaler Lautstärke. Konkurrenz wird nicht geduldet. Solch ein Maß an negativer Emotion ist ab einem bestimmten Alter kaum noch zu ertragen. Die Sehnsucht nach Ruhe und Versöhnlichkeit lässt sich nicht überschreien. Nicht dauerhaft.
Natürlich hielt Punk auch Einzug in die Literatur. Einer der wichtigsten Vertreter war Rainald Goetz. Jahrgang 1954. Als Psychiatrie-Student, startete er mit Berichten aus der Club-Szene. Diese Texte, publiziert in den Siebziger Jahren, wären heute der Alptraum jedes „Sensibilitätslektors“: Die Liste der Triggerwarnungen wäre länger als das Manuskript selber.
In Texten wie „Subito“ montiert Goetz die krassesten Sprüche, die er zu hören bekam. Darin gelten Frauen oft als dumm oder schamlos, Männer dagegen als autodestrúktiv. Motto: „Wir saufen, bis Blut kommt.“ Oder: „Ohne Blut logisch kein Sinn. Und weil ich kein Terrorist nicht geworden bin, deshalb kann ich bloß in mein eigenes weißes Fleisch schneiden.“ Und genau das würde er tun: Als Goetz 1983 beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb über moralinsaure Platzhirsche wie Günther Grass her zog, nahm er eine Rasierklinge und schnitt sich die Stirn auf. So ganz nebenbei. Das Blut über sein Gesicht, tropfte auf den Tisch. Der Skandal war perfekt, und der Autor berühmt. Dass Goetz damals bereits die Dreißig überschritten und Punk „auf dem zweiten Bildungsweg“ erlernt hatte, störte nicht. Sein Roman-Debut „Irre“ handelte von einem Psychiater mit dem Namen des RAF-Terroristen Raspe. Der kämpft nicht nur gegen den Wahn der Patienten, sondern auch gegen gleichgültige Institutionen. Die Kranke oft abfertigten, deren Qualen noch steigerten.
Als das Schauspiel Bonn die Goetz-Bühnentrilogie „Krieg“, „Schlachten“, „Kolik“ auf die Bühne brachte und damit zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde, hatte der junge Wilde ein weiteres Medium gefunden. Charaktere oder Handlung? Fehlanzeige. Die Dialoge bestanden aus Fetzen, Fragmenten, Mitschnitten aus den Medien und isolierten Kraftausdrücken. Ein Gesellschafts-Panorama mit Personen wie „Heidegger“, „Stammheimer“ oder einem „Chor der mündigen Bürger“. Im ersten Teil ging es um Überlebenskämpfe im öffentlichen Raum. Der zweite thematisierte den Terror innerhalb der Familie. Und der dritte, ein Monolog, präsentierte individuelle Selbstzerfleischung.
In den 1990ern wechselte Goetz zum Rave. Ein intellektueller Techno-Apologet, der dem damaligen DJ-Guru Sven Väth auch mal das Equipment hinterhertrug. Mancher Feuilletonist belächelte den Mittvierziger als „Berufsjugendlichen“. Ein Image, das Goetz selbst befeuerte: Dass er im letzten Jahr nach katholischem Ritus heiratete und mehrfach Vater geworden ist, gilt heute als ebenso kurios wie früher seine Punkliteratur. Dass sein Image dennoch ramponiert wurde, das gelang dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der verlieh Goetz im Jahre 2018 das Bundesverdienstkreuz. Der endgültige Gnadenschuss. Aber wie heißt es so schön: Unsere Leichen leben noch. Und das gilt auch für Goetz.
Im vergangenen Jahr meldete sich der 71jährige zurück. Mit dem Dramenband „Lapidarium“. Darin enthalten: Die Stücke „Reich des Todes“, „Baracke“ und eben „Lapidarium“: Das erste umkreist den 11. September 2001, den US-Angriff auf den Irak und die Folter in Guantanamo. „Baracke“ hingegen zeigt – wie schon in „Schlachten“ - das Hacken, Metzeln und Hauen innerhalb der Familie. Und als letztes: „Lapidarium“. Das fragt nach dem Ende, dem Tod, dem Unwiederbringlichen. Vor vier Wochen brachte das Münchener Residenztheater es zur Uraufführung.
Formal bleibt der Autor sich treu: Keine Szenen, sondern Montagen aus Satzfetzen, Dialogen oder Kurzessays. Da einen roten Faden auszumachen, eine Bilderwelt zu erfinden, bleibt Aufgabe der jeweiligen Regie. Ein Handlungsstrang dreht sich um die Serie „Kir Royal“, einem TV-Hit der achtziger Jahre. Nahm Münchens Schickeria und ihre Paparazzis aufs Korn. Hochkarätig besetzt mit Senta Berger, Ruth Maria Kubitschek, Franz-Xaver Kroetz, und so weiter.
In „Lapidarum“ fragt Regisseur Helmut Dietl den Autor Rainald Goetz: Ob er nicht eine Fortsetzung von „Kir Royal“ schreiben wolle. Neuer Titel: „Lost“. Zu Deutsch: Verloren. Das absurde Angebot lässt schmunzeln. Aber nur kurz. Dann dämmert: Die „Kir Royal“-Macher sind entweder tot oder im Greisenalter. Niemand bleibt verschont.
Goetz lässt auch eine Zombie-Armee damaliger Hochkultur auferstehen. Ob Herbert Achternbusch oder der fiktive Herr Geiser aus Max Frischs Novelle „Der Mensch erscheint im Holozän“. Ebenfalls dabei: Gerhard Polt oder der Maler Albert Oehlen. Sie alle, ob lebendig oder tot, stehen für Vergänglichkeit. Auch Rainald Goetz hat den Herbst seines Lebens erreicht.
„Lapidarium“ schließt mit dem Monolog eines Sterbenden. Der allgegenwärtige Krieg – er ist verschwunden. Medizynische Auslassungen aus dem Frühwerk: Vorbei! Nicht einmal die Krankheit wird genannt. Null Pathos, null Spiritualität, kein Übermaß an Trauer. Keine Hasstiraden gegen den Knochenmann. Manchmal, kurze Anspielungen auf Christliches und Hölderlin-Zitate. Erinnerung an die verlorene Religion? Dann sein letztes Wort: „Ja, ich bin bereit“.- Als letzte Worte fast bescheiden. Und doch: Nichts ist schwerer.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bild: 26. SEPTEMBER 2012 - BERLIN: Rainald Goetz bei einer Lesung seines neuesten Romans „Johann Holtrop“, Deutsches Theater, Berlin
Bildquelle: 360b / Shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut