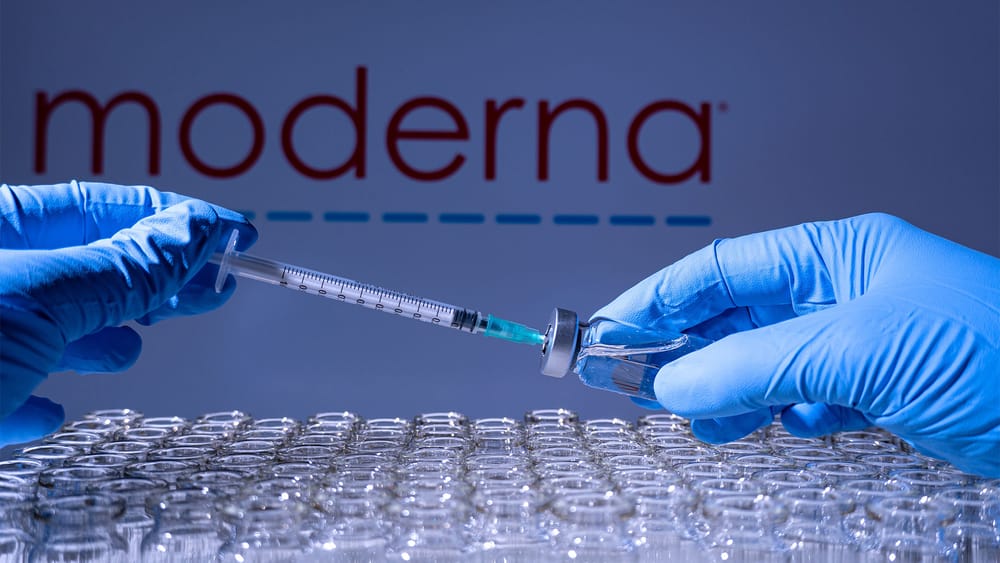Der neue Fünf-Jahr-Plan gilt als weiterer Schritt zur Verwirklichung einer modernen sozialistischen Gesellschaft in China. Dieses Ziel soll 2049 zum hundertjährigen Jubiläum der Volksrepublik erreicht werden. Welche Rolle spielt dabei die wirtschaftliche Entwicklung?
Ein Meinungsbeitrag von Rüdiger Rauls.
Chinas Wirtschaftswunder
Für den Aufbau einer neuen Gesellschaft ist die Entwicklung der Produktivkräfte von entscheidender Bedeutung. Bis zu Beginn der 2020er Jahre bestand Chinas Wirtschaftspolitik weitgehend in der Bekämpfung der Armut im eigenen Land bei gleichzeitigem Ausbau der Exportwirtschaft. Mit deren Überschüsse wurden Ausbau und Modernisierung der Wirtschaft gefördert. Die Nachfrage am chinesischen Markt selbst war nicht so groß, dass sie unter den Exporten gelitten hätte, geschweige denn dass sie diese hätte ersetzen können.
Menschen, die bittere Armut gewohnt waren, bleiben noch lange bescheiden und streben nach der Überwindung der Armut nicht gleich nach Luxus. Das war auch so bei den europäischen Völkern nach den Entbehrungen der Weltkriege. Das Konsumverhalten erstreckte sich in erster Linie auf die Deckung der Grundbedürfnisse. Darüber hinaus legte man das Geld zurück. Chinas Sparquote ist seit Jahren eine der höchsten der Welt. Doch Sparneigung und Kaufzurückhaltung wurden immer mehr zum Problem für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.
Die geringe Konsumneigung, Corona und Donald Trumps erster Zollkrieg am Ende der 2010er Jahre führten zu einer starken Beeinträchtigung der chinesischen Wirtschaft. Besonders die Exporteinnahmen gingen zurück, und die inländische Nachfrage reichte nicht aus, um diese Einbußen wett zu machen. Diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten begegnete die chinesische Führung mit dem Konzept der zwei Kreisläufe.
Zusätzlich zur Exportwirtschaft wurde der inländische Konsum stärker gefördert. Die Sozialsysteme wurden ausgebaut, der Mindestlohn erhöht, Familien und Einkommensschwache erhielten mehr Unterstützung. Das Dienstleistungsgewerbe wurde insgesamt gefördert und ausgebaut. Gezielte Subventionen im Bereich E-Commerce-Logistik, Straßenbau, digitale Netze und sonstige Maßnahmen sollten besonders die Armut im ländlichen Raum bekämpfen und dessen Haushalte stärker am Binnenmarkt teilhaben lassen.
Für die chinesische Exportwirtschaft rückten besonders die Märkte in Südostasien, Afrika und Südamerika in den Vordergrund, mit denen im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) die Zusammenarbeit bereits stark gewachsen war. Die Bedeutung der USA als Exportmarkt für chinesische Waren ging zurück. China hatte sich auf eine Entwicklung eingestellt, die sich mit Trumps erstem Zollkrieg schon angedeutet hatte, die zunehmende Einschränkung des freien Warenverkehrs. Auch die Europäer schwenkten unter den Begriffen „De-Risking“ und „Diversifizierung“ auf diese Linie ein. Die Zeitenwende betraf nicht nur den Umgang mit Russland sondern auch mit China.
Denn die Volksrepublik war unter der Losung „Made in China 2025“ zu einem Wirtschaftsgiganten aufgestiegen, der den bisherigen Platzhirschen am Weltmarkt schmerzhaft Konkurrenz machte. Im Verlauf der 2020er zeigte sich neben der politischen Zweiteilung der Welt immer mehr auch die Zweitteilung des Weltmarktes. Diese Entwicklung hatten die Kommunistische Partei und die chinesische Gesellschaft dank ihrem materialistischen Denken vorweggenommen. Trumps zweiter Zollkrieg traf sie deshalb nicht unvorbereitet. Unvorbereitet war dagegen Trump, der offensichtlich nicht damit gerechnet hatte, dass die Chinesen ihm derart hartnäckig und erfolgreich Widerstand leisten könnten.
Ertragsschwäche
Aber alle Vorbereitung auf diese Veränderungen konnten das Kernproblem der chinesischen Wirtschaft nicht aufheben: die niedrige Inlandsnachfrage und die hohen Produktionskapazitäten, die einen offenen Weltmarkt brauchen. „Von 2020 bis 2024 stieg Chinas Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe von 26,6 Billionen Yuan [3,69 Billionen US-Dollar] auf 33,6 Billionen Yuan [4,7 Billionen US-Dollar]“(1). Damit deckt die Wirtschaft der Volksrepublik etwa dreißig Prozent der weltweiten Industrieproduktion ab.
Das bedeutet aber auch, dass ein erheblicher Teil der weltweiten Nachfrage für Chinas Warenausstoß zur Verfügung stehen muss. Diese Nachfrage wird durch Trumps Zölle künstlich eingeschränkt, gleiches versuchen auch die Europäer. Wenn auch Chinas Ausfuhren und Wirtschaft wachsen, so hat seit Trumps erstem Zollkrieg die Ertragskraft der chinesischen Wirtschaft dennoch nachgelassen. Die chinesischen Erzeugerpreise sanken und damit sanken auch die Erträge ihrer Wirtschaftstätigkeit.
Staatliche Programme zur Inzahlungnahme von Gütern des täglichen Bedarfs steigerten die Umsätze der Unternehmen. Mit Zuschüssen verbilligte der Staat künstlich den Erwerb solcher Erzeugnisse. Man vermied staatlich verordnete Preissenkungen zur Nachfragebelebung, weil diese gerade das Problem der Ertragsschwäche verstärkt hätten. Die Zuschüsse förderten die Nachfrage und brachten zusätzliche Gelder von den Sparkonten der Chinesen in den Wirtschaftskreislauf.
Die Einzelhandelsumsätze erreichten mit 12,47 Billionen Yuan [etwa 1,6 Bill Euro] im ersten Quartal 2025 einen Zuwachs von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch mit der Ausweitung der Umsätze ist das Problem der mangelhaften Ertragskraft nicht behoben. Auch wenn Chinas Wirtschaftswachstum im Vergleich mit den führenden kapitalistischen Staaten immer noch sehr gut dasteht, ist man sich dessen bewusst, dass die Wirtschaft produktiver werden muss. Die Lösung sieht die kommunistische Partei in einer neuen Wirtschaftspolitik unter dem Begriff „qualitativ hochwertige Entwicklung“.
Modernisierung der Industrie
Dieses Konzept betrifft nicht nur die Förderung von Zukunftstechnologien sondern auch die Ergebnisverbesserung der herkömmlichen Industrien. China will deren Massenproduktion nicht aufgeben. Es hat aus den Fehlern der führenden kapitalistischen Staaten gelernt, durch die der Aufstieg der Volksrepublik begünstigt worden war. Seit den 1960er Jahren hatten die westlichen Staaten Wirtschaftszweige mit geringerer Wertschöpfung und Qualifikationsanforderungen wie Textil-, Schuh- und andere Industrien in Billiglohnländer ausgelagert.
Teilweise machen das auch chinesische Unternehmen. Pekings Ziel aber ist es, die Massenproduktion in China zu halten, sie jedoch so weit zu modernisieren, dass weiterhin eine ertragreiche Produktion im Inland stattfindet. Diese ist derzeit noch gekennzeichnet durch umfangreiche Überkapazitäten in manchen Wirtschaftsbereichen. Deren gewaltiger Warenausstoß verursacht Druck auf die Preise nicht nur in China, sondern weltweit. Dadurch sinkt die Wertschöpfung. Denn auch andere Länder drängen mit ihren Massenprodukten wie Stahl oder Kraftfahrzeuge auf den Weltmarkt.
Die kapitalistische Lösung für Überkapazitäten und nachlassende Ertragskraft besteht darin, den Ausstoß der Produktion weiter zu erhöhen, um die Konkurrenten unter Preisdruck zu setzen und aus dem Markt zu drängen. Dieses Verfahren ist teuer und riskant. Erhebliche Kapitalmengen müssen für Ausbau oder Rationalisierung von Produktionsanlagen aufgewendet werden, und es ist nicht klar, wer am Ende den längeren Atem hat. Aber dieser westliche Weg kennt keine andere Lösung, weil allein die Besitzer der Produktionsmittel über deren Verwendung bestimmen. Staat und Gesellschaft können nur am Ende die Scherben dieses Konkurrenzkampfes beseitigen.
Um die herkömmliche Industrie zu modernisieren, betrachtet Peking es als nötig, alte und unproduktive Kapazitäten allmählich abzubauen und durch leistungsfähigere zu ersetzen. Die Produktion soll der Nachfrage angepasst werden durch eine effizientere Produktion unter dem Einsatz modernerer Herstellungsverfahren. Ablauf und Steuerung der Produktion erfahren einen „umfassenden Wandel, bei dem KI [Künstliche Intelligenz] schnell zum unverzichtbaren Motor der industriellen Entwicklung Chinas wird“(2).
Schon jetzt „steht China an der Spitze der weltweiten KI-Innovation und -Bereitstellung und dient als beispielloser Maßstab für die Unternehmenstransformation.“(3). Der Anteil chinesischer Industrieunternehmen, die große KI-Modelle einsetzen, „ist von 9,6 Prozent im Jahr 2024 auf 47,5 Prozent im Jahr 2025 sprunghaft angestiegen.(4) Verstärkt führen staatliche Stellen nun Gespräche mit Unternehmen und Verbänden über Abbau und Regulierung der Überkapazitäten sowie die Neugestaltung der Produktion.
Man will die eigene Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt erhöhen bei gleichzeitiger Steigerung der Wertschöpfung. Wenn China auch die Entwicklung von Hochtechnologie massiv fördert, will man dennoch die industrielle Basis nicht verlieren. Diesen Fehler haben die USA gemacht, indem US-Unternehmen Spitzenleistungen in der Hochtechnologie erreichten, aber gleichzeitig durch Vernachlässigung und Auslagerung der Industriebetriebe die eigenen Lieferketten schädigten.
Chinas Modernisierungspläne bedeuten ein Umdenken in der Produktion und eine Neugestaltung der Produktionsgrundlagen in der herkömmlichen Industrie: Weg von der Muskelkraft hin zur Kraft der Roboterarme, die um ein Vielfaches schneller, genauer und belastbarer sind, also insgesamt wirkungsvoller als die Muskelkraft. So wie die Dampfmaschine, Verbrennungs- und Elektromotoren die Zugkraft von Mensch und Tier ersetzten, so setzen nun Roboter in den Industriebetrieben diese Entwicklung fort. Sie steigern die Ergiebigkeit menschlicher Arbeitskraft, indem sie deren Muskelkraft und Motorik nicht nur ersetzen, sondern um ein Vielfaches steigern. Damit steigt der Ertrag von Arbeitskraft und Unternehmen.
Chinas Entwicklungsphilosophie
Noch ist die „qualitativ hochwertige Entwicklung“ in China ein Schlagwort, das sich zwar immer mehr in der Öffentlichkeit und den Medien niederschlägt, aber wie sie umgesetzt werden soll, ist offiziell noch nicht festgelegt. Diese Klarstellung wird sicherlich Bestandteil des 15. Fünfjahrplanes werden, der in den nächsten Monaten mit der Unterstützung der Bevölkerung aufgestellt werden wird.
In einer öffentlichen Befragung vom 20. Mai bis 20. Juni waren über 3,11 Millionen Meinungen und Vorschläge zu diesem Vorhaben eingegangen. „Diese Ansichten werden gesammelt und veröffentlicht, um als Grundlage für den Entscheidungsprozess zu dienen.“ (5).
Solche Befragungen sind Bestandteil des chinesischen Verständnisses von Demokratie. Sie finden zu wesentlichen gesellschaftlichen Fragen und Entscheidungen statt. worin sich die chinesische von den Vorstellungen der westlichen repräsentativen Demokratie unterscheidet. Das gilt für den neuen Fünfjahrplan ebenso wie für die Wege der qualitativ hochwertigen Entwicklung. Die chinesische Führung vertritt den Grundsatz, „dass die Früchte der Modernisierung dem Volk zugute kommen sollen, dass die Zufriedenheit des Volkes der Maßstab für den Fortschritt ist“ (6).
Das sind Denkweisen, die den meisten Menschen im politischen Westen fremd sind, besonders den Feinden Chinas und den westlichen Meinungsmachern, die seit Jahr und Tag kein gutes Haar an der Volksrepublik lassen. Diese lassen lieber die überschaubare Zahl der Kritiker Chinas in ihren Medien zu Wort kommen als Stimmen aus jenem Millionenheer, das durch die Politik der kommunistischen Partei der bitteren Armut und der Hoffnungslosigkeit des Elends entkommen ist. Wie sich die Politik der „qualitativ hochwertigen Entwicklung“ auf China und das Leben der Menschen auswirkt, wird zu beobachten bleiben.
Es wird auch zu beobachten bleiben, wie diese sozialistische Gesellschaft aussehen wird, die China anstrebt. Das ist eine ganz neue nicht nur gesellschaftliche Entwicklungsstufe, sondern auch neu für die marxistische Gesellschaftsanalyse. Denn so weit war die praktische Verwirklichung des Sozialismus bisher noch nie vorangeschritten. Erstmals in der Menschheitsgeschichte gestaltet er eine Gesellschaft, deren wirtschaftliches Niveau weit vorangeschritten ist und das der entwickelten kapitalistischen Länder bereits teilweise überholt hat.
Quellen und Anmerkungen
(2, 3, 4) Chinanews (ecsn) 18.8.2025 KI treibt Chinas industrielle Entwicklung voran
(5) Chinanews 4.8.2025 Xi betont Schlüsselrolle der öffentlichen Meinung
+++
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse.
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Frachthafenanlage neben der Flagge Chinas
Bildquelle: FOTOGRIN / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut