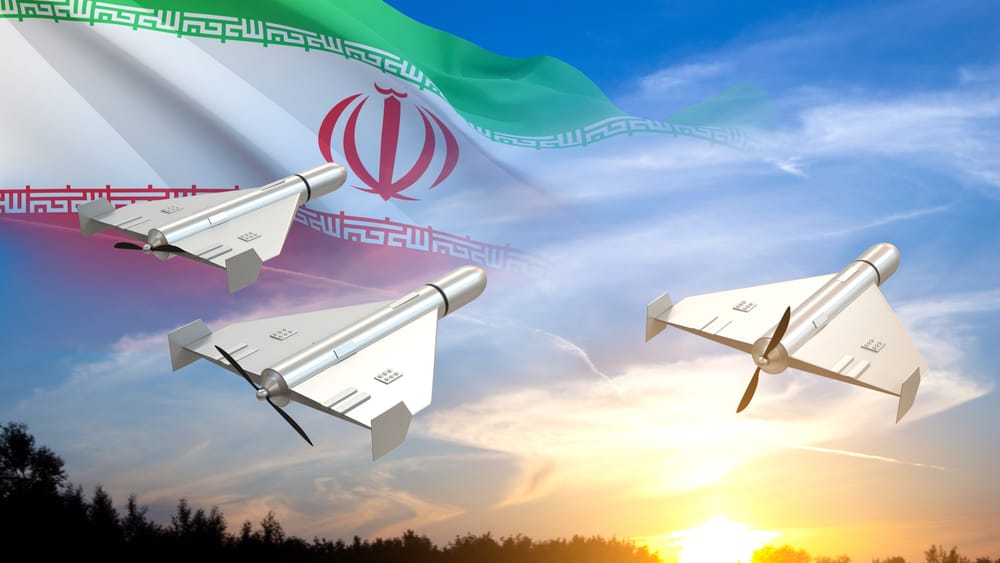Kraftvolle Vergangenheit und beeindruckende Gegenwart – China im Fokus westlicher Geopolitik
Ein Meinungsbeitrag von Wolfgang Effenberger.
2016 brachte der damalige US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump das Buch „Great Again! Wie ich Amerika retten werde“ heraus. Im Kapitel 4 (Außenpolitik für den Frieden) wies er darauf hin, dass Chinas Wirtschaft in den vergangenen Dekaden jedes Jahr um phänomenale neun bis zehn Prozent gewachsen ist und prophezeite, dass China innerhalb der nächsten zehn Jahre die Vereinigten Staaten als weltgrößte Wirtschaft ablösen wird. Auf seine eigene Frage „was haben wir unternommen, um sie zu besiegen?“ antwortete er:
„Wir haben uns kampflos ergeben“. Darauf folgte die Feststellung: „Es gibt Menschen, die sich wünschen, ich würde China nicht als unseren Feind bezeichnen. Aber genau das ist das Land doch!“ (1)
Verhältnis China-USA: Wandel vom Partner zum strategischen Konkurrenten
Nun, die USA hatten sich 2016 nicht kampflos ergeben. Schon unter US-Präsident George W. Bush (jun.) und seiner Außenministerin Condoleezza Rice setzte die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China ein. Bush entfernte sich nach seinem Amtsantritt bewusst vom Konzept der "strategischen Partnerschaft" seines Vorgängers Clinton und charakterisierte das Verhältnis als "strategischen Wettbewerb". Die US-Regierung erhöhte gezielt den Druck in den Bereichen Menschenrechte, Proliferation und Taiwan-Frage. Das US-Raketenabwehrprogramm mit seinen Auswirkungen auf das strategische Gleichgewicht verschärfte zusätzlich die Konflikte, weil es als Bedrohung der chinesischen Sicherheit und Abschreckungsfähigkeit wahrgenommen wurde. (2)
Condoleezza Rice und die Regierung Bush nutzten die Situation der Uiguren (dafür wurden die in Guantanamo einsitzenden uigurischen Terroristen freigelassen) vermehrt als politisches Hebelthema: In Reden und offiziellen Stellungnahmen wurde China wiederholt zu Menschenrechtsreformen und zur politischen Öffnung aufgefordert, wobei die Lage in Xinjiang und die Behandlung der Uiguren explizit als kritischer Punkt angeführt wurden. Diese Rhetorik sollte Druck auf Peking ausüben, trug aber zur Verfestigung der Gegensätze bei. Insgesamt war die Bush-Administration geprägt von einer schrittweisen Abkehr der kooperativen Linie und dem Aufbau einer strategischen Gegenposition, die später zu der Handels- und Sanktionspolitik führte, die auch unter US-Präsident Barack Obama fortgeführt wurde.(3) Im September 2014 wurde von der Obama-Administration im US-Langzeitstrategie-Dokument TRADOC 525-3-1 „Win in a Complex World 2020-2040“ der Konflikt mit China festgeschrieben. In diesem Papier haben die US-Streitkräfte den Auftrag erhalten, in den beiden Dekaden die von China und Russland ausgehende Bedrohung abzubauen.
Schon in seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump in seiner neuen „Nationalen Sicherheitsstrategie“ am 18. Dezember 2017 China neben Russland als „revisionistische Macht“ bezeichnet und zu einem „strategischen Konkurrenten“ ("long-term strategic competitor") erklärt, was die Transformation der Beziehung von Kooperation hin zu intensiver Konkurrenz und Rivalität markiert. Diese Rivalität ist multidimensional und umfasst wirtschaftliche, technologische, militärische und geopolitische Aspekte, wie z.B. den Wettbewerb im Südchinesischen Meer oder technologische Überlegenheit.
Zu den wichtigsten Schritten des strategischen Wechsels zählen:
- Die Einführung umfassender Sonderzölle auf chinesische Waren (ab 2018), als Reaktion auf das hohe Handelsdefizit sowie der Vorwurf des Technologiediebstahl und unfaire Wettbewerbsbedingungen.
- Der Wegfall multilateraler Initiativen wie der Trans-Pacific Partnership (TPP) zugunsten eines national orientierten “America First”-Kurses und bilateraler Druckmaßnahmen.
- Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, Exportbeschränkungen für Hochtechnologien wie Halbleiter und Listen chinesischer Firmen ("Entity List"), denen Investitionen und Geschäftsbeziehungen in den USA verwehrt wurden.
- Die Erhöhung der militärischen Präsenz und demonstrative “Freedom of Navigation”-Operationen im Südchinesischen Meer zur Zurückweisung chinesischer Gebietsansprüche.
- Politische Gegenmaßnahmen wegen Menschenrechtsverletzungen (z.B. Uiguren, Hongkong) durch gezielte Sanktionen und Gesetze.
- Die verstärkte Einbindung regionaler Verbündeter wie Japan, Australien und Indien sowie die strategische Ausrichtung des gesamten Indo-Pazifikraums auf die Eindämmung Chinas.
Diese Entscheidungen sind sowohl aus wirtschaftlichen als aus sicherheitspolitischen Erwägungen getroffen worden und markieren einen fundamentalen Paradigmenwechsel in den sino-amerikanischen Beziehungen.
Unter Präsident Trump verstärkte sich der Protektionismus, verbunden mit der Abkehr von multilateralen Institutionen und Bündnissen, wodurch die USA ihre Rolle als wohlwollender globaler Hegemon zugunsten einer transaktionalen Großmacht zurücknahmen.
Insgesamt vollzog sich der Wandel Chinas von Partner zu strategischem Konkurrenten durch eine Kombination aus geopolitischem Machtstreben, wirtschaftlichem Wettbewerb und sicherheitspolitischen Rivalitäten, die heute das Leitparadigma der internationalen Beziehungen bilden. (4)
Weiter schilderte Trump in Kapitel 4 „Außenpolitik für den Frieden“ seine Herangehensweise an die Außenpolitik: Er wolle von einem starken Fundament von einer Position aus agieren – mit dem stärksten Militär der Welt. “Wenn die Menschen wissen, dass wir, wenn nötig, Gewalt anwenden werden und das es uns ernst damit ist, wird man anders mit uns umgehen: Mit Respekt!“ Diese Politik kann nun 2025 konkret beobachtet werden.
Folgen für China als strategischer Konkurrent der USA
Aufgrund Chinas dynamischer Entwicklung sind die internationalen Beziehungen zwischen den USA und China für die globale Entwicklung von kaum zu unterschätzender Bedeutung.
Als die US-Strategen des Training and Doctrine-Command ihre Visionen zu Papier brachten, standen die BRICS-Staaten noch in ihrem Anfangsstadium. 2009 hatten sich erstmals die Außenminister von Brasilien, Russland, Indien und China im sibirischen Jekaterinburg zum informellen Austausch getroffen. Ein Jahr später hatte sich Südafrika angeschlossen. Bereits 2001 hatte sich schon die »Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit« (SOZ) gebildet. Auf die Bedeutung dieser Organisation, die sich inzwischen zu einem ernstzunehmenden Verteidigungsbündnis entwickelt hat, habe ich am 25. Juli 2009 in meiner Rede „Neue Kriege um Rohstoffe“ anlässlich des Friedensfestivals vor dem Brandenburger Tor hingewiesen:
„Die SOZ wird vielfach als die geopolitische und zusehends auch militärische Antwort Russlands und Chinas auf die Seidenstraßenstrategie (von US-Präsident Bill Clinton 1999) gesehen. Mitglieder der SOZ sind China, Russland, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan. Das entspricht etwa einem Viertel der Weltbevölkerung. Beobachterstatus haben Afghanistan, Indien, Iran, die Mongolei und Pakistan. Teheran scheint indes auch zunehmend Unterstützung bei den Ländern Zentralasiens und insbesondere in der SOZ zu finden. Das könnte dazu führen, dass die SOZ im Fall eines Konflikts mit den USA gleich vier Atommächte als Verbündete hinter sich weiß“.
Am 31. August und 1. September 2025 fand in Tianjin der Gipfel der SOZ statt, die inzwischen mit zehn Mitgliedstaaten (China, Indien, Pakistan, Russland, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, Iran und Belarus), zwei Beobachterstaaten (Afghanistan und Mongolei) und mehreren Dialogpartnern eine bedeutende Rolle in der internationalen Politik spielt. Dieses Jahr sind auch Armenien, Aserbaidschan und die Türkei anwesend, deren Teilnahme den westlichen Mächten verdächtig ist. Die Beziehungen zwischen Indien und China, traditionell von Spannungen geprägt, verändern sich merklich in Richtung Kooperation und Freundschaft, auch als Reaktion auf Trumps Wirtschaftspolitik, die Indien mit 50% Strafzöllen belegt hat.
Der indische Präsident Modi und der Vorsitzende der KPC, Xi Jinping, haben ihre Bereitschaft zum Dialog und zur Zusammenarbeit betont und setzen auf eine Neugestaltung der globalen Ordnung, wie Präsident Xi auf dem SOZ-Gipfel sagte. Er beklagte die anhaltendenden hegemonialen Bestrebungen der USA und rief dazu auf, ein gerechteres, ausgewogeneres internationales System zu schaffen. Russland und China bekräftigten ihre umfassende strategische Partnerschaft und streben eine alternative wirtschaftliche, finanzielle und politische Ordnung an, die nicht mehr vom Veto der USA oder Europas abhängig ist. Die aktuellen politischen Dynamiken der SOZ- und BRICS-Gipfel spiegeln eine Festigung der Beziehungen zwischen Russland, China und Indien wider, man will gemeinsam Alternativen zum US-geführten internationalen System vorantreiben.
Durch die rasante Entwicklung der Organisationen BRICS und SOZ sind die Strategiepläne von 2014 zwar im Ziel unverändert geblieben, in der Vorgehensweise jedoch angepasst.
Noch sind die USA und China sowohl global als auch regional – im Asien-Pazifik-Raum – die herrschenden Mächte.
Noch ist die militärische Dominanz der USA mit ihrem Dutzend Flugzeugträgerflotten und dem weltweit höchsten Militärbugdet von annähernd 1.000 Milliarden US-Dollar (China fällt mit einem Drittel weit ab) ungebrochen. Dafür ist China der größte Exporteur, während die USA der größte Importeur sind. Zudem ist China der größte ausländische Kreditgeber der USA, bei rasanter Zunahme chinesischer Investitionen in den USA.
So verwundert es kaum, dass das Verhältnis zwischen den beiden Supermächten von wachsenden Spannungen und einer ernormen Konkurrenz geprägt ist. Schon am 11. Januar 2018 schrieb David Shambaugh in monde-diplomatique unter dem Titel „Rivalen, Partner, Gegner“, dass es gefährlich werden würde, wenn sich beide nicht vertragen. Für ihn wäre es schon ein Erfolg, wenn diese Dynamik nicht in offene Feindschaft mündet.
Unzweifelhaft ist nicht nur die Asien-Pazifik-Region, sondern die ganze Welt auf ein friedliches und stabiles Verhältnis zwischen den USA und China angewiesen.
Das wird jedoch nur dann möglich sein, wenn die USA ihre Staatsräson des Exzeptionalismus und damit das Streben nach einer unipolaren Weltordnung (bzw. nach dauerhaften Vorteilen/Biden 2022) aufgeben und sich in Augenhöhe mit China in eine multipolare Weltordnung einbringen. Für ein friedliches Miteinander muss globale Mitbestimmung ernst genommen werden und müssen Entscheidungen der Mehrheit akzeptiert werden. Vor diesem Hintergrund kann eine vielfältigere Weltordnung entstehen, in der es darum geht, einen neue globalen nachhaltigen Konsens zu finden. Das wäre durchaus mit den westlichen Wertvorstellungen kompatibel. „Je früher wir damit anfangen, desto besser und desto größer die Chance, dass möglichst viele unserer Werte in die neue Weltordnung einfließen“. (5)
EU und Medien eingespannt im Kriegsgeschirr
Anfang Oktober 2025 schrieb mir ein Freund aus Shanghai: „Westliche Medien verunglimpfen China ständig, zum Beispiel nutzt die AFP [Agence France-Press, W.E.] immer einen dunklen, bedrohlichen Stil, um chinesische Soldaten zu fotografieren. Aber gerade dieser Stil findet bei chinesischen Internetnutzern riesige Beliebtheit. Ich schicke dir ein paar Fotos – die AFP wollte China verunglimpfen, aber stattdessen hat sie die Stärke Chinas noch besser zum Ausdruck gebracht.“
Eines dieser Bilder zeigt eine Paradeaufnahme chinesischer Soldaten bei Sonnenuntergang mit dramatischer Spiegelung am Boden. Solche dramatischen Belichtungen werden in Bildjournalismus wie auch in Propagandadarstellungen verwendet, um Stärke, Disziplin oder nationale Symbolik visuell zu betonen. Dramatische, kontrastreiche Beleuchtung – etwa das Bild im Sonnenuntergang mit grellem Orange und dunklen Schatten – erzeugt eine intensive Stimmung, die Emotionen wie Ehrfurcht oder Angst weckt. Die Spiegelung verstärkt das Bild, indem sie Vielzahl, Tiefe und Bedrohlichkeit visuell multipliziert.
Militärfotografie wird bewusst genutzt, um ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen, häufig Macht und Wehrhaftigkeit, die je nach Betrachtung auch bedrohlich wirken kann. Diese Aufnahme war ein gutes Beispiel dafür, wie durch Bildgestaltung ein imposantes, potenziell bedrohlich wirkendes Bild militärischer Präsenz geschaffen wird. Wie der Betrachter das empfindet, wird jedoch von der Affinität zu den Kriegsparteien abhängen.
Die AFP Motor im Propagandafeldzug
Unter den weltweit wichtigsten Nachrichtenagenturen ist die AFP (Agence France-Presse), Reuters und AP (Associated Press) die älteste (1835) und betreibt eines der weltweit dichtesten Korrespondentennetze mit Büros in etwa 165 Ländern und liefert mehrsprachige Nachrichten, Fotos, Videos und Multimediaprodukte. (6)
Seit 2017 betreibt AFP Faktencheckdienste in Kooperation mit digitalen Plattformen wie Meta (Facebook) und weiteren Partnern und ist zudem Mitgründer des Netzwerks GADMO (German-Austrian Digital Media Observatory), das gemeinsam mit dpa, der Austria Presse Agentur (APA) und Correctiv systematisch im Sinn und Auftrag der Regierungen gegen sogenannte Desinformation arbeitet. Das europäische Netzwerk European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) überprüft angeblich, ob dieses Angebot internationalen Qualitätsstandards folgt. (7)
Das EFCSN ist ein Netzwerk von europäischen Faktenprüfungsorganisationen, das 2020 mit EU-Unterstützung gegründet wurde, ein Zusammenschluss von derzeit über 60 Faktencheck-Organisationen aus mehr als 30 europäischen Ländern, darunter AFP, Correctiv, APA, DPA und weitere. Die Mitglieder verpflichten sich, strengste Standards zu Unabhängigkeit, Transparenz und journalistischer Qualität einzuhalten, die im „Europäischen Kodex für unabhängige Faktencheck-Organisationen“ festgelegt sind.
Das EFCSN veranstaltet Konferenzen, betreibt eigene Projekte zu Wahlen, Klima oder KI und fördert Austausch und Weiterbildung unter den Fact-Checking-Teams Europas. Zu den deutschsprachigen EFCSN-Mitgliedern zählen unter anderem Correctiv, DPA, APA und Medizin Transparent.
2017, als die AFP ein eigenes, internationales Team aus Faktencheck-Journalisten zu betreiben begann, schuf die EU das Verteidigungs- und Sicherheitspolitik-Instrument PESCO (Ständige Strukturierte Zusammenarbeit), das tiefere militärische Zusammenarbeit etablierte und gemeinsame Projekte der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Verteidigung ermöglichte. Ziel ist die Stärkung der europäischen militärischen Fähigkeiten, die operative Zusammenarbeit und die Kooperation der europäischen Rüstungsindustrie.
PESCO wurde als ein verbindliches Kooperationsinstrument zur Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik geschaffen. Die teilnehmenden EU-Staaten verpflichten sich zu folgenden zentralen Punkten:
- Systematische Erhöhung der Verteidigungsausgaben, inklusive Fixierung auf mindestens 20% zur Verbesserung der operativen Einsatzbereitschaft und Interoperabilität der Streitkräfte.
- Gemeinsame Rüstungs- und Infrastrukturprojekte zur Synchronisierung militärischer Fähigkeiten und Ausbau der militärischen Infrastruktur: die wichtigsten Kriegstrassen Straße und Bahn vom Kanal und der Nordsee zur Ostflanke .
All dies dient dem Ziel, die militärische Handlungsfähigkeit Europas in einem sicherheitspolitisch verschärften Umfeld zu erhöhen. Langfristig wird auch über eine stärkere Integration der europäischen Streitkräfte diskutiert, manchmal mit Blick auf eine Art europäische Armee oder Verteidigungsunion. Diese Entwicklungen zeigen deutlich eine Orientierung zur Erhöhung der Kriegsbereitschaft und einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit unter den Teilnehmerstaaten. (8)
Während das European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) offiziell als zivilgesellschaftliches Netzwerk zur Förderung von Faktenchecks und Bekämpfung von Desinformation fungiert, muss im politischen Kontext die Unterstützung solcher Initiativen als Teil einer umfassenderen EU-Strategie gesehen werden, die vor allem im Kontext der Kriegsvorbereitung steht.
Insgesamt zeigen die EU-Initiativen eine starke Ausrichtung auf operative Kooperation und strategische Kontrolle, was man als Erhöhung der Kriegsbereitschaft bezeichnen kann.
Belege dafür finden sich vorrangig in sicherheitspolitischen und friedenswissenschaftlichen Analysen, die auf folgende Punkte hinweisen:
- Eskalation durch Aufrüstung und Militarisierung
Die Verteidigungsinitiativen können von Nachbarstaaten oder geopolitischen Rivalen wie Russland oder China als Bedrohung wahrgenommen werden, was zu einer Verschärfung der internationalen Konfliktdynamik führt.
- Vertrauensverlust und Rivalität
Dadurch werden geopolitische Gräben vertieft und ein Dialog unmöglich gemacht, wodurch diplomatische Konfliktlösungen erschwert werden. (9)
- Politische Instrumentalisierung von Sicherheits- und Informationsnetzwerken
Netzwerke wie das European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) können zwar zivilgesellschaftlich legitimiert sein, aber in einem hybriden Konfliktumfeld auch als Instrument der Informationskontrolle oder Propagandabekämpfung fungieren. Diese Instrumentalisierung könnte Spannungen erhöhen, wenn Staaten Informationssouveränität als Mittel zur Einflussnahme oder Abgrenzung nutzen. (10)
- Dokumentierte Sicherheitsrisiken durch Militarisierung
Militärische Aufrüstung dient nicht nur zur Abschreckung, sondern verstärkt bei gleichzeitiger Instabilität und ungelösten Konflikten die Gefahr von „kriegerischen Auseinandersetzungen“.
Initiativen wie PESCO und sicherheitspolitisch gewertete EU-Unterstützungen für Netzwerkprojekte (wie EFCSN) dienen nicht der eigenen Sicherheit, sondern erhöhen die Konfliktgefahr, treiben die westlichen Länder bei spürbaren Wohlstandsverlust und steigenden Zukunftsängsten in eine gigantische Schuldenfalle und sind kontraproduktiv für mögliche Friedensentwürfe. (11)
Menschenrechte als Kampfbegriff
Der Ausdruck „Kampfbegriff Menschenrechte“ bezeichnet die politische und strategische Verwendung des Begriffs „Menschenrechte“ im internationalen Diskurs, besonders in Konflikten, zur Delegitimierung oder Rechtfertigung bestimmter politischer Handlungen. Ursprünglich als universelles Ideal konzipiert, dienen Menschenrechte in aktuellen Debatten oft als rhetorische Waffe oder Legitimationsinstrument. (12) Als „Kampfbegriff“ entzieht sich das Konzept der Menschenrechte seiner neutralen, universalen Bedeutung und wird zur politischen Waffe – sowohl zur Anklage gegen andere Staaten als auch zur Rechtfertigung eigener Politik oder militärischer Maßnahmen.
So wird der chinesischen Regierung unter Präsident Xi Jinping u.a. vorgeworfen, über ein Jahrzehnt hinweg die Kontrolle weiter zentralisiert und die unabhängige Zivilgesellschaft sowie Grundfreiheiten wie Meinungs-, Versammlungs-, Presse- und Religionsfreiheit nahezu abgeschafft zu haben. (13)
In Xinjiang spricht die UNO und Amnesty International sprechen von „schweren Menschenrechtsverstößen“ und möglichen „internationalen Verbrechen“, darunter willkürliche Masseninhaftierungen, Folter, Überwachung und kulturelle Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang (seit 2005 benutzt die US-Regierung das Thema Uiguren als Hebel gegen die Regierung in Peking).
Laut Berichten führender Menschenrechtsorganisationen und Medien hat sich die 2025 die Menschenrechtslage in den USA insbesondere unter der aktuellen Regierung von Präsident Trump deutlich verschlechtert. Massive Einschränkungen betreffen die Rechte von Migranten und Minderheiten sowie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Massenabschiebungen, Familientrennungen und neue Asylbeschränkungen haben zu großer Unsicherheit und Angst vor Verfolgung für Migranten geführt. Die Diskriminierung von Minderheiten nahm eher zu, etwa durch Abschaffung von Diversity-, Gleichstellungs- und Inklusionsprogrammen (DEI) und die Einschränkung von Rechten für Trans-Menschen – darunter Ausschluss vom Militär.
Proteste, etwa zu Gaza oder sozialen Themen, wurden häufig mit Festnahmen, Schikanen und Abschiebungsandrohungen beantwortet; insbesondere an Hochschulen wird eine abweichende Meinung gezielt unterdrückt.
Medienschaffende und regierungskritische Berichterstattung geraten stark unter Druck, der Zugang zu politischer Information wird eingeschränkt.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist vor allem für Nicht-US-Bürger gefährdet, die wegen Aktivismus für palästinensische oder andere umstrittene Themen abgeschoben werden. (14)
Kommt in den USA auf ca. 180 Bürger ein Gefangener, so ist es in China ca. einer pro 800 Einwohner. In den USA ist die hohe Inhaftierungsrate stark geprägt von sozialen und ethnischen Ungleichheiten, mit einer besonders hohen Rate bei Afroamerikanern. Zudem ist das Strafrechtssystem auf hohe Inhaftierung ausgelegt, was zu Kosten von über 50 Milliarden US-Dollar jährlich führt. Beide Länder haben hohe Gefangenenzahlen, die USA aber weltweit die höchste Pro-Kopf-Rate.
In den alternativen Medien kursierte in den vergangenen Wochen eine Liste der 15 Top-Länder mit den meisten Verhaftungen wegen Online-Postings. In dieser Rangliste wurde Deutschland mit 3.500 Festnahmen im Zusammenhang mit Online-Postings angegeben, was im internationalen Vergleich Platz drei hinter Belarus und einen Platz vor China bedeutet. Allerdings sind diese Zahlen umstritten und nicht exakt belegbar, da detaillierte Statistiken speziell zu Festnahmen wegen Online-Kommentaren in Deutschland fehlen. Das Bundeskriminalamt erklärt, dass zwar mehrere tausend politisch motivierte Hasspostings (Volksverhetzung etc.) jährlich erfasst werden, doch genaue Festnahmedaten sind nicht veröffentlicht. Insgesamt werden die Statistiken des Bundeskriminalamts nach politischen Gesichtspunkten bzw. Rücksichtnahmen geglättet, ein Vorgehen, dass vor allem bei autoritären Staaten wie China oder Belarus besonders angeprangert wird. (15)
Faktenchecker wie der Tagesschau-Faktenfinder weisen in ihrer Recherche darauf hin, dass die „3.500“-Zahl vor allem über soziale Medien und in nicht-journalistischen Online-Grafiken verbreitet wurde und keine offizielle Polizeistatistik oder unabhängige Quelle hinterlegt ist. Weder das Bundeskriminalamt noch das Bundesinnenministerium haben für das Jahr 2023 eine solche Zahl bestätigt oder publiziert. Hier wird ausschließlich auf die Zahl 3.500 abgehoben – dagegen lässt die Aussage offen, ob es vielleicht 3.499 oder 3.501 sein könnten.
Die imperialen Ziele der Großmächte China und USA im Jahr 2025
China verfügt über eine 5.000-jährige kontinuierliche Kulturgeschichte mit einer langen Tradition von Zivilisation, Philosophie und Verwaltung.
Die kulturelle Identität ist durch Konfuzianismus, Daoismus und eine zentralisierte Staatsführung geprägt, die trotz Brüchen und Fremdeinflüssen eine bemerkenswerte Kontinuität bewahrt hat. China war historisch gesehen vor allem ein kontinentales Reich ohne expansive imperiale Ambitionen außerhalb der asiatischen Region, mit dem Fokus auf Harmonie und Ordnung („Tianxia-Konzept“)
Im Vergleich dazu sind die USA ein relativ junges Land mit rund 200 Jahren Geschichte als Nation, geprägt von Expansion, Konflikten und vor allem gewaltsamer Eroberung, Vertreibung und Ermordung der indigenen Bevölkerung durch europäische Siedler.
Der Konfuzianismus in China förderte eine hierarchische, harmonische und pflichtbewusste Gesellschaft, in der das Individuum in ein soziales Gefüge eingegliedert ist.
Die westlichen Ideologien legen hingegen Wert auf individuelle Rechte, persönliche Freiheit und demokratische Teilhabe, was oft mit sozialem Wandel und Konflikten einhergeht. Diese unterschiedlichen Grundkonzepte prägen bis heute die politischen und gesellschaftlichen Systeme Ostasiens und des Westens.
Heute verfolgt China mit der „Made in China 2025“-Strategie das Ziel, technologisch eigenständig und global führend zu werden, gerade in Hightech-Bereichen wie KI, Halbleitern, Raumfahrt und erneuerbaren Energien. Mit der „Belt and Road“ Initiative (Neue Seidenstraße) strebt China nach globaler wirtschaftlicher und geopolitischer Expansion durch Investitionen in Infrastruktur, Rohstoffquellen und strategische Hafenanlagen weltweit, vor allem in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa.
China baut gezielt die wirtschaftliche und technologische Abhängigkeit anderer Länder auf, um seine Einflusszone zu erweitern und sich geopolitisch abzusichern.
Die militärische Modernisierung und Präsenz, vor allem im Südchinesischen Meer und rund um Taiwan, ist Teil der Strategie, regionale Dominanz und globale Ansehen als Großmacht zu sichern.
Die USA verfolgen dagegen eine Strategie der Erhaltung einer globalen Führungsrolle durch militärische Präsenz weltweit, Bündnissysteme (NATO, QUAD etc.) und technologische Innovationsführerschaft. Durch Industriepolitik, Sanktionen und Exportkontrollen wollen sie den Aufstieg Chinas und anderer Rivalen eindämmen und eigene technologische Standards sichern. Sie konzentrieren sich darauf, ihre strategischen Allianzen zu festigen und Einflusszonen gegen Rivalen abzugrenzen, insbesondere im Indo-Pazifik. Wirtschaftlich streben sie nach der Sicherung von globalen Handelswegen, dem Zugang zu Rohstoffen und der Führerschaft in Zukunftstechnologien. Chinas imperiale Ziele sind technologische Selbständigkeit, wirtschaftliche globale Expansion mit wachsendem politischen Einfluss und regionaler Militärmacht. Die USA dagegen setzen auf globale militärische Führerschaft, Innovationsvorsprung und Blockbildung gegen Rivalen, insbesondere China.
Bei der prekären Finanzlage der USA (sie stehen vor dem Bankrott) ist dieses Dominanzstreben für die übrige Welt höchst gefährlich, denn als Ausweg bleibt da nur der Krieg gegen die Aufstiegsmacht China (beide befinden sich in der sogenannten Thukydides-Falle (17)).
Am 29. September 2025 erschien in Foreign Affairs, der Hauspostille des Council on Foreign Relations (CFR), der mit „China geht in die Offensive“ überschriebene Artikel von Jeffrey Prescott und Julian Gewirtz. Sie verweisen auf die Anfang September 2025 von Chinas Präsident Xi Jinping in Tianjin gehaltene zentrale Rede bei der 25. Sitzung des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Er betonte darin die Notwendigkeit einer gerechteren und ausgewogeneren globalen Regierungsführung angesichts wachsender weltweiter Herausforderungen und Krisen. Xi verurteilte die fortdauernde Mentalität des Kalten Krieges sowie Machtpolitik und Protektionismus scharf und rief dazu auf, Mauern abzubauen statt neue zu errichten, Zusammenarbeit zu fördern statt zu behindern.
Als Teil seiner Rede kündigte Xi die „Global Governance Initiative“ an, mit der China eine aktivere Rolle bei der Gestaltung des internationalen Systems anstrebt. Er forderte die Achtung der Souveränität aller Staaten, die Befolgung des Völkerrechts, echte multilaterale Zusammenarbeit sowie menschenzentrierte Politik und konkrete Taten. Xi stellte gleichzeitig Chinas Bereitschaft heraus, den Fortschritt in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und wirtschaftliche Entwicklung mit anderen zu teilen, und formulierte eine klare Absage gegen hegemoniale Machtpolitik.
Diese Rede markiert einen strategischen Weckruf Chinas, Weltordnung und Zusammenarbeit nach eigenen Vorstellungen neu zu formen, den Aufruf zu einer multipolaren, kooperativer gestalteten Welt. (18)
Müssen nun die USA auch in die Offensive gehen?
China dürfte inzwischen stark genug sein, waffentechnisch wie mental, dass die USA ihr militärisches Ziel gemäß „Win in a Complex World 2020-2040“ nicht mehr umsetzen können.
Ende September 2025 hat China eine Inter-kontinentalrakete (ICBM) mit Hyperschall-Boost-Glide-Technologie im Pazifik getestet, wobei die Reichweite rund 11.000 Kilometer betrug und das Einschlagsgebiet sich in den offenen Gewässern nahe Französisch-Polynesien befand. Bei dem Test wurde eine moderne Rakete auf einer sogenannten "depressed trajectory" (abgesenkten Flugbahn) gestartet, was die Abfangbarkeit durch existierende Raketenabwehrsysteme deutlich erschwert. (19) Experten sehen darin einen strategischen Technologiesprung, denn Hyperschall-Boost-Glide-Fahrzeuge kombinieren extreme Geschwindigkeit und hohe Manövrierfähigkeit, sodass sie klassische Frühwarn- und Abwehrsysteme unterlaufen können. (20)
Eine deutliche Machtdemonstration und ein Signal an die USA, Japan und andere regionale Akteure? (21)
Wie wird der aktuelle Konflikt Unipolar vs. Multipolare Welt enden?
Im Geleitwort für die deutsche Ausgabe seines im Sommer 2023 geschriebenen Buches „Der Westen im Niedergang. Ökonomie, Kultur und Religion im freien Fall“ schreibt Emmanuel Todd im Sommer 2024 in Paris:
„Seit dem Irakkrieg und den gemeinsamen Pressekonferenzen von Wladimir Putin, Gerhard Schröder und Jacques Chirac [es fand im Rahmen eines Dreiergipfels im russischen Urlaubsort Sotschi am 30. August 2004 statt, im Dezember 2004 dann die 'orangene Revolution' in der Ukraine, W.E.] leben die Vereinigten Staaten in Angst vor einer strukturellen Annährung zwischen Deutschland und Russland, die das Ende des US-amerikanischen Einflusses auf Europa bedeuten würde. Von diesem Standpunkt aus betrachtet stellt es für die Vereinigten Staaten einen maßgeblichen Erfolg dar, dass sie die Europäische Union in einen Konflikt mit Russland verwickeln konnten, sogar auf die Gefahr hin, deren Wirtschaft mehr zu schaden als der Russlands. Die energiepolitische und industrielle Verbindung zwischen Deutschland und Russland ist zum aktuellen Zeitpunkt zusammengebrochen.“
Weiter prognostiziert Todd, dass die Vereinigten Staaten diesen Krieg verlieren werden, weil ihre industriellen und militärischen Mittel gegen ein wiedererstarktes Russland unzureichend sind. Die bevorstehende Niederlage der Ukraine sowie die Erniedrigung des Pentagons und der NATO werden die Frage nach den künftigen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland wieder aufkommen lassen. Dann wird Deutschland zwischen einem endlosen Konflikt und dem Frieden mit Russland wählen müssen. Für Deutschland ist dies ein sehr altes Thema.
Im Kern des Buches analysiert Todd die regressive Dynamik der US-amerikanischen Gesellschaft. Laut Todd wird der Fall des Westens nicht durch einen russischen Sieg, sondern durch einen Zerfall der USA von innen heraus erfolgen.
„Einen Krieg des Westens im Tiefland der Ukraine, weniger als 1000 Kilometer von Moskau entfernt, zu unterstützen, bedeutet für Deutschland also nicht, endlich auf der richtigen, sondern erneut – wie aus Versehen – auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen.“ (22)
Anmerkungen und Quellen
Wolfgang Effenberger, Jahrgang 1946, erhielt als Pionierhauptmann bei der Bundeswehr tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete "atomare Gefechtsfeld" in Europa. Nach zwölfjähriger Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft sowie Höheres Lehramt (Bauwesen/Mathematik) und unterrichtete bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik. Seitdem publiziert er zur jüngeren deutschen Geschichte und zur US-Geopolitik. Zuletzt erschienen vom ihm: „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020) sowie "Die unterschätzte Macht" (2022)
+++
1) Donald Trump: GREAT AGAIN! Kulmbach 2016, S. 60
3) https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29817/die-chinapolitik-der-usa/ | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/24501
4) https://monde-diplomatique.de/artikel/!5473507 | https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020S01/
5) Frank Sieren: China to go. München 2023, S. 13
6) https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/bildung-lernen/nachrichtenagenturen | https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/PuF_I_02_Nachrichtenagenturen.pdf
7) http://www.afp.com/de/unser-angebot/afp-faktencheck | https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kampf-gegen-desinformation-deutsche-beteiligung-neuen-experten-plattformen-2022-12-01_de | https://www.instagram.com/afpfaktencheck/
8) https://defence-network.com/pesco-permanent-structured-cooperation/ | https://www.ethikundmilitaer.de/ausgabe/2018-02/article/nur-eine-weitere-nutzlose-sicherheitsinitiative-russlands-blick-auf-pesco
10) https://phaidra.univie.ac.at/open/o:1270206
11) https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/1419/file/disshkm.pdf | https://www.ethikundmilitaer.de/ausgabe/2018-02/article/nur-eine-weitere-nutzlose-sicherheitsinitiative-russlands-blick-auf-pesco
12)https://monde-diplomatique.de/artikel/!849861 | https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/217184
13) https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/china | https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/
17) Der Begriff Thukydides-Falle (englisch: Thucydides Trap), basiert auf einem Zitat des antiken athenischen Historikers und Strategen Thukydides, wonach der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta aufgrund der Furcht Spartas vor der wachsenden Macht Athens unvermeidlich gewesen sei. Der US-amerikanischenPolitikwissenschaftler Graham T. Allison führte den Begriff ein, der eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Krieg beschreibt, wenn eine aufstrebende Macht eine bestehende Großmacht als regionalen oder internationalen Hegemon zu verdrängen droht. Er wird vor allem verwendet, um einen potenziellen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China zu beschreiben.
19) https://www.graphicnews.com/media/GN/46319/C/jpg/NL
20) https://defencesecurityasia.com/en/china-hypersonic-icbm-test-depressed-trajectory-boost-glide/
22) Emmanuel Todd: Der Westen im Niedergang. Ökonomie, Kultur und Religion im freien Fall. 2004 Neu-Isenburg, S. 12
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Schachbrett mit zwei Schachfiguren mit den Flaggen Chinas und der USA
Bildquelle: UnImages / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut