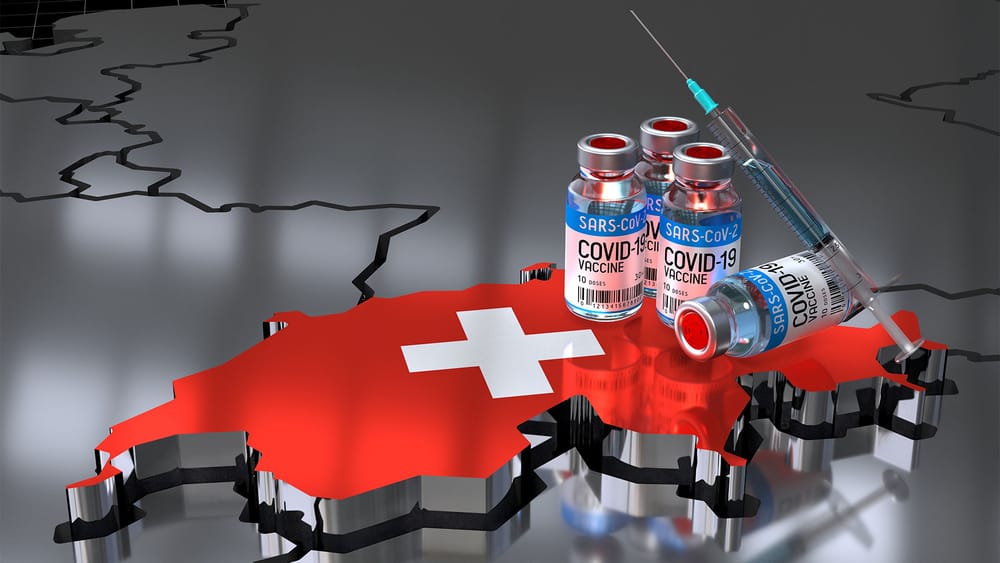Ein Kommentar von Tilo Gräser.
In Deutschland wird am Sonntag wieder gewählt: Ein neuer Bundestag muss her, nachdem die «Ampel»-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Herbst 2024 zerbrach. In der Folge wird es auch eine neue Regierung geben, je nachdem, welche der 29 zur Wahl stehenden Parteien entsprechend viele Stimmen bekommen.
«Wenn das Wählen etwas ändern würde, wäre es illegal» – das hat die russischstämmige US-Aktivistin Emma Goodman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts festgestellt. Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain meinte zuvor:
«Wenn das Wählen etwas ändern würde, würden sie es uns nicht erlauben, es zu tun.»
Das dürfte bis heute gelten, so dass von den Ergebnissen am Sonntag in Deutschland kaum tatsächliche Veränderung zu erwarten ist. Sicher dürfte dabei aber sein: «Stärkste» Kraft nach ihrem Anteil an den Wahlberechtigten und nach absoluten Zahlen dürften wieder die Nichtwähler sein, die keiner der Parteien eine wirkliche Veränderung zutrauen. Bei der letzten Bundestagswahl waren das bei einer Wahlbeteiligung von 76,4 Prozent der rund 61,17 Millionen Wahlberechtigten immerhin 14,44 Millionen Nichtwähler (23,6 Prozent).
Zum Vergleich: Die SPD, die vor knapp vier Jahren die Wahl mit einem Stimmenanteil von 25,7 Prozent gewann, verzeichnete in absoluten Zahlen 11,9 Millionen gültige Stimmen. Doch die Macht der Nichtwähler verpufft, da sie beim Ergebnis und der Platzverteilung vom Wahlsystem ignoriert werden, wie auch die ungültigen Stimmen und alle Parteien, die unter fünf Prozent einkommen.
Der Parteienforscher Uwe Jun aus Trier erwartet, dass die Wahlbeteiligung am Sonntag etwas höher als 2021 sein könnte. Er rechnet mit etwa 80 Prozent der diesmal nur 59,2 Millionen Wahlberechtigten, wie er in einem Interview mit dem Sender SWR erklärte. Das wären in absoluten Zahlen voraussichtlich 11,8 Millionen Nichtwähler. Wenn die CDU mit knapp 30 Prozent „gewinnt“, wie sich nach bisherigen Umfragen andeutet, dann hätte sie absolut 14,2 Millionen Stimmen (soweit diese alle gültig sind). Bleibt es bei einer Wahlbeteiligung ähnlich wie 2021 hätten wir knapp 14 Millionen Nichtwähler und entsprechend 13,6 Millionen Stimmen für die CDU (wenn alle gültig wären). Am Sonntag werden wir mehr wissen, ob die Nichtwähler wieder die „stärkste Kraft“ sind.
Anhaltend hohe Nichtwählerzahl
Jun rechnet mit einer höheren Wahlbeteiligung, weil dieser Wahlkampf „relativ stark politisiert“ sei. Davon künden unter anderem die Demonstrationen „gegen Rechts“ in den letzten Wochen, mit denen die anderen Parteien versuchen, die Wirkung der AfD zu begrenzen. Politikwissenschaftler wie Lea Elsässer und Armin Schäfer machen darauf aufmerksam, dass neue politische Konkurrenten (wie aktuell das Bündnis Sahra Wagenknecht; BSW) die politische Polarisierung verstärken und
"möglicherweise Bürger mobilisieren, die sich in der Vergangenheit der Wahl (oder allgemeiner der Beteiligung) enthalten haben – weil sie diese Parteien entweder unterstützen oder bekämpfen wollen".
Da die Politik konfliktanfälliger werde, könnten sich auch die Beteiligungsmuster ändern.
Doch der „falsche Protest“, wie ihn der Psychotherapeut Dr. Hans-Joachim Maaz in einem Beitrag im Magazin „Manova“ bezeichnete, bringt zwar viele Tausende auf die Straße. Ob er Einfluss auf die Wahl hat, wird sich zeigen, denn er dient laut Maaz den regierenden Parteien vor allem dazu, von ihrer Verantwortung für die politische und gesellschaftliche Lage abzulenken. Ob sich bisherige Nichtwähler davon beeindrucken lassen, ist fraglich. Zu ihren Motiven gehört eine große Unzufriedenheit mit der Politik und der Eindruck, dass ihre Interessen nicht von den zur Wahl stehenden Parteien vertreten werden, wie Studien zeigen.
Diese Entwicklung hält seit Jahrzehnten an und zeigte sich erstmals bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen 1990, wie zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Sabine Pokorny 2022 in einer Analyse der Motive der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2021 für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) schrieb. Damals sei die Wahlbeteiligung erstmals unter 80 Prozent gesunken und habe mit der Ausnahme 1998 (82,2 Prozent) dann 2009 mit 70,9 Prozent den bisherigen Tiefpunkt erreicht. Pokorny verweist darauf, dass sich unter den Nichtwählern „eine weitverbreitete Unzufriedenheit mit Politik, Politikerinnen und Politikern sowie politischen Parteien“ zeige.
Das „mit Abstand wichtigste Motiv“, der Wahl 2021 fernzubleiben, sei die Annahme gewesen, Parteien und Politiker machten, was sie wollten, weshalb es keinen Sinn mache zu wählen. 65 Prozent der für die Studie befragten Nichtwähler hätten dem zugestimmt. Mehr als die Hälfte von ihnen habe erklärt, es habe keinen Politiker gegeben, dem er oder sie seine oder ihre Stimme geben wollte. Als weitere Motive wurden angegeben, dass sich keine Partei für Dinge einsetze, die den Nichtwählern wichtig seien, und:
„Ich wollte meine bisherige Partei nicht mehr wählen, aber es gefiel mir auch keine andere.“
Laut Pokorny liegt der Anteil derjenigen, die generell nicht wählen gehen, bei einem Drittel der Nichtwähler, hat aber seit 2005 zugenommen. Ein weiteres Drittel von ihnen interessiere sich grundsätzlich nicht für Politik, während 25 Prozent ihre Nichtbeteiligung damit begründen würden, dass ihnen der Staat als Ganzes nicht gefällt. „Dass vor der Wahl schon klar war, wer gewinnt und es deshalb auf die einzelne Stimme nicht angekommen sei“, hat demnach etwa ein Fünftel angegeben. Die wenigsten hätten ihre Nichtwahl als „Denkzettel“ für die etablierte Politik verstanden.
Sozial ungleiche Wahlbeteiligung
Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hat 2023 ebenfalls eine Studie zur Frage „Wer fehlt an der Wahlurne?“ veröffentlicht. Der Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Universität Mainz hat dafür ebenfalls die Bundestagswahl 2021 analysiert. Er beschreibt ein Muster bei den Nichtwählern (23,4 Prozent):
„Je ärmer ein Wahlkreis oder ein Stadtteil ist, desto niedriger fällt die Wahlbeteiligung dort aus.“ Und: „Im Vergleich zu den 1970er oder 1980er Jahren fällt die Wahlbeteiligung heute nicht nur niedriger, sondern auch ungleicher aus.“
Schäfer stellt fest, die Wahrscheinlichkeit, nicht wählen zu gehen, sei ungleich über soziale Gruppen verteilt. Im Vergleich zu 2017 habe sich die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2021 „so gut wie nicht verändert“ und wo sie in der Vergangenheit niedrig (oder hoch) ausfiel, sei das auch 2021 der Fall gewesen. Keiner der beteiligten Parteien sei es im Vergleich zu 2017 vier Jahre später gelungen, Nichtwähler nennenswert zu mobilisieren, auch der AfD nicht. Die „sozialräumlichen Muster der Nichtwahl“ stünden in Verbindung mit den Parteiergebnissen:
„Linkspartei, SPD und AfD erzielen die besten Ergebnisse dort, wo die Wahlbeteiligung niedrig ausfällt, wohingegen die Unionsparteien, FDP und die Grünen in Gegenden besser abschneiden, wo die Wahlbeteiligung hoch ist. Dies sind ausnahmslos Wahlkreise und Stadtteile mit geringer sozialer Problemlast, was sich unter anderem an einer niedrigen Arbeitslosenquote und einem hohen Durchschnittseinkommen zeigt.“
Es seien „immer besonders arme Stadtteile, in denen wenige Wahlberechtigte wählen, und die höchste Wahlbeteiligung findet sich in den besten Wohngegenden“, schreibt der Autor und nennt Hamburg-Billstedt, Köln-Chorweiler oder Berlin-Marzahn als Beispiele für typische Nichtwählerhochburgen, während in begüterten Vierteln wie Hamburg-Eppendorf, Köln-Hahnwald oder Berlin-Zehlendorf die Wahlbeteiligung weiterhin sehr hoch ausfalle. Schäfer macht einen negativen Zusammenhang aus:
„Je höher die Arbeitslosenquote und je höher der Anteil geringer Einkommen ist, desto niedriger ist auch die Wahlbeteiligung.“
Die sozial und in der Folge gesellschaftlich „Abgehängten“, die in prekären Lebensverhältnissen ihre Existenz sichern müssen, gehen seltener zur Wahl als Menschen der bürgerlichen Mitte oder der Oberschicht, wie ein Bericht aus dem Jahr 2017 zeigte. Darin wurden von Langzeitarbeitslosen als Motive für das Nichtwählen angegeben: Fehlendes Vertrauen in die Politik, verlorener Glauben an Sinn und Regeln der Demokratie sowie den Zweck von Wahlen, das Gefühl der Ausgrenzung sowie der Eindruck, dass es keine wirkliche Wahl gebe.
Die erwähnte KAS-Studie von 2022 stellt dazu fest:
„Ein beträchtlicher Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler sieht keinen Sinn darin, wählen zu gehen, da Parteien und Politiker doch machten, was sie wollten. Hierin drückt sich ein Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber politischen Entscheidungen aufseiten der Nichtwählerinnen und Nichtwähler aus.“
Das ist nicht nur in geringeren Ressourcen und schlechteren Bildungsraten sozial benachteiligter Menschen begründet, was bei diesen zu geringerer Wahlbeteiligung führt, wie es in Studien dazu heißt. Das ist auch begründet darin, dass es „deutlichen Zusammenhang zwischen den getroffenen politischen Entscheidungen und den Einstellungen von Personen mit höherem Einkommen, aber keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang für die Einkommensschwachen“ gibt. Zu diesem Ergebnis kamen die Politikwissenschaftler Lea Elsässer, Svenja Hense und Armin Schäfer 2017 in einer Analyse.
Schlechtere politische Chancen
Sie stellten fest, dass „Arme, prekär Beschäftigte oder formal Geringgebildete nicht dieselbe Chance haben, dass ihre Anliegen im politischen Prozess gehört und umgesetzt werden“, wie Menschen mit höheren Einkommen. Dass stelle grundlegende Versprechen der Demokratie wie das auf gleiche Teilhabe für alle in Frage. Auch in der Bundesrepublik zeige sich,
„dass politische Entscheidungen mit höherer Wahrscheinlichkeit mit den Einstellungen höherer Einkommensgruppen übereinstimmen, wohingegen für einkommensarme Gruppen entweder keine systematische Übereinstimmung festzustellen ist oder sogar ein negativer Zusammenhang“.
Für Vorstellungen von Bürgern mit geringem Einkommen, so in der Außen-, aber auch der Wirtschafts- und Sozialpolitik, hätte es „in den Jahren von 1998 bis 2015 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit“ gegeben, umgesetzt zu werden.
Zu den Ursachen der Entwicklung verweisen die Autoren unter anderem darauf, dass es eine Überrepräsentation oberer Schichten in den gewählten Parlamenten gebe, „die in den letzten Jahrzehnten fast überall zugenommen hat. Im Bundestag sei besonders der hohe Anteil von Akademikern auffällig, aber auch die Berufsstruktur weiche deutlich von der der Gesamtbevölkerung ab. Eine der drei Autoren, die Politikwissenschaftlerin Elsässer, hatte 2018 ihre Dissertation über soziale und politische Ungleichheit als Buch veröffentlicht und darin gefragt „Wessen Stimme zählt?“.
Sie untersuchte dafür die politischen Entscheidungen auf Bundesebene von 1980 bis 2013 darauf, welche sozialen Schichten mit ihren Interessen berücksichtigt wurden. Zu den Ergebnissen gehört,
„dass die politischen Entscheidungen des Deutschen Bundestages in den letzten dreißig Jahren systematisch zulasten unterer sozialer Klassen verzerrt waren“.
Dagegen hätten sich die Präferenzen oberer Berufs- und Einkommensgruppen in den parlamentarischen Beschlüssen und Reformen widergespiegelt. Keine der regierenden Parteien und Koalitionen habe sich für die Interessen unterer sozialer Klassen eingesetzt und diese in die politischen Entscheidungen eingebracht. Das betrifft laut Elsässer aber auch die mittleren sozialen Gruppen.
Diese „Schieflage“ zeige sich besonders bei hoch umstrittenen Politikvorschlägen. Ihre Untersuchung belegt, dass das „Gefühl weniger privilegierter sozialer Gruppen, kein Gehör bei den Verantwortlichen in der Politik zu finden“, eine reale Grundlage hat. Menschen mit wenig Einkommen, einfache Angestellte und Arbeiter in Deutschland erleben demnach „sehr viel seltener als Selbstständige oder Beamte“, dass ihre politischen Vorstellungen auch entsprechend Gehör finden und umgesetzt werden. Elsässer warnte 2018:
„Wenn Menschen langfristig die Erfahrung machen, dass die von ihnen als wichtig erachteten Probleme nicht oder nicht in ihrem Sinne politisch behandelt werden, dann liegt es nahe, dass sie in der Folge das Vertrauen in politische Prozesse oder Institutionen verlieren.“
An diesem Befund hat sich nichts geändert – weil sich die zugrundeliegenden Verhältnisse und Zusammenhänge nicht geändert haben.
Die Zusammensetzung des neuen Bundestages wird auch diesmal nur ein schiefes Bild der politischen Stimmungslage in Deutschland wiedergeben. Daran ändert sich genauso wenig wie an den Grundlinien der bundesdeutschen Politik, bis hin zu Kriegshetze und Russophobie sowie der Ignoranz gegenüber den Interessen der breiten Bevölkerungsmehrheit egal, wer regieren wird, weil er die Wahl „gewonnen“ hat.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bildquelle: ArTono / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut