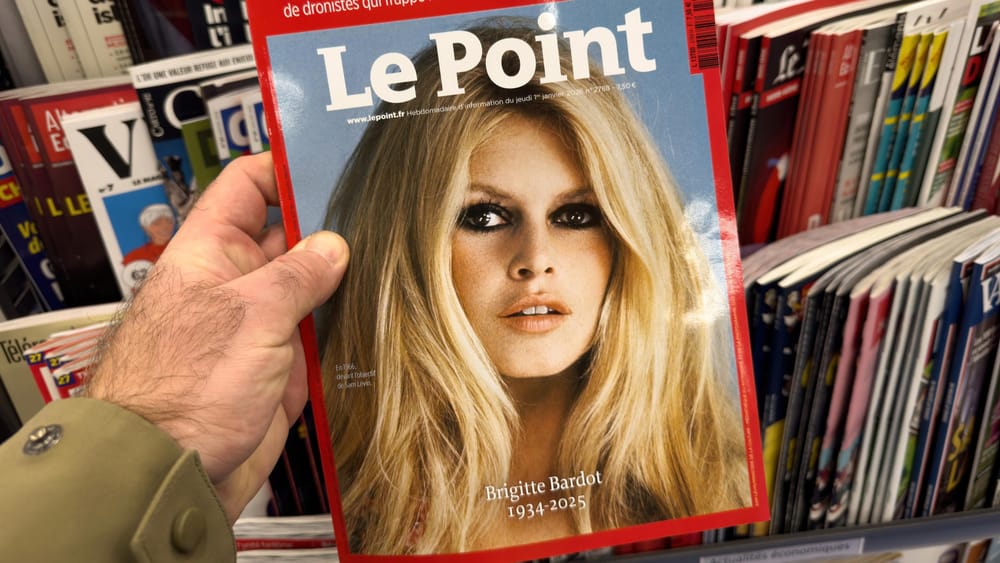Ein Interview von Andrea Drescher mit Andreas Peglau.
Wie werden aus Lesern und Kommentatoren alternativer und sozialer Medien Menschen, die ins Handeln übergehen? Diese Frage treibt mich zunehmend um, da ich den Eindruck habe, dass selbst unter Systemkritikern die Lethargie immer mehr zunimmt. „Man kann ja eh nichts tun“ ... und dann tut man auch nichts. Was diejenigen, die die Dinge tun, die von den Kritikern kritisiert werden, natürlich freut. Denn sie profitieren davon, wenn sich immer mehr kritische Menschen wieder in ihre Komfortzone zurückziehen.
Aufgrund verschiedener Artikel von mir auf tkp.at hatte mich der Psychologe und Psychotherapeut Andreas Peglau vor einigen Wochen angeschrieben und mich über seine Arbeit „Wir sind keine geborenen Krieger“ informiert. Sein Artikel, der nicht nur in 10 verschiedenen Sprachen, sondern auch als Hörbuch zur Verfügung steht, begeisterte mich auf Anhieb. Andreas Peglau ist 1957 in der DDR geboren, hat einen kritischen Blick auf beide Welten, forscht u.a. zu dem Psychoanalytiker Wilhelm Reich und schien daher ein idealer Ansprechpartner für meine Frage zu sein.
Im daraus resultierenden Interview begaben wir uns auf die Suche nach Antworten zu: „Kann man Menschen aktivieren – und falls ja, wie?“
Was hindert aus Deiner Sicht die Menschen daran, aktiv zu werden, auch wenn absehbare Gefahren auf sie zukommen?
Also da gibt es sicherlich eine Menge Faktoren, aber der Faktor, der mir besonders wichtig ist und von dem ich am meisten Ahnung habe, ist der psychologische. Unsere ganz normale, also übliche Erziehung und Sozialisation ist schon seit Jahrhunderten autoritär – Stichwort Patriarchat.
Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass wir mit mindestens dem gleichen Repertoire an Möglichkeiten, uns und unsere Umwelt wahrzunehmen, auf die Welt kommen wie Pflanzen und Tiere. Und die wissen, was sie brauchen, was ihnen guttut und was ihnen schadet. Ein Baum findet Licht und bildet Wurzeln in der Erde, bis er an die benötigten Nährstoffe und Wasser rankommt. Ich bin überzeugt, wir kommen auf die Welt mit einem noch viel weiter entwickelten Kompass in uns. Wir wissen, was für uns gut oder schlecht ist, was uns nutzt oder schadet.
Blieben wir so, erhielten wir uns diese Wahrnehmung, diesen Kompass, würden wir auch gesellschaftliche, soziale Fehlentwicklungen, die uns betreffen, sehr schnell wahrnehmen und uns dagegen – einfach aus einem gesunden Selbsterhaltungswunsch heraus – auch wehren.
Das genau passiert aber nicht, da wir durch die Erziehung von der Geburt an in Kindergärten, in Schulen, in der Ausbildung und im Beruf in eine andere Richtung gedrängt werden, die sich meines Erachtens mit dem Begriff autoritär gut zusammenfassen lässt.
Der innere Maßstab wird zerstört. Wir werden ständig mit der Botschaft konfrontiert: Nicht du zählst, nicht das, was du fühlst und willst, zählt, sondern das, was die Autoritäten, die Eltern, die Lehrer und die Vorgesetzten sagen, ist wichtig. Die sagen dir, was richtig und was falsch ist, deine Gefühle sind irrelevant.
Und das fängt mit dem wieder üblicher gewordenen Kaiserschnitt an, oder dem Stillplan bei Babys und zieht sich durch die ganze Zeit, bis man erwachsen ist. Das gilt natürlich in Abstufungen, trifft nicht jeden gleichermaßen, aber ich glaube, alle kriegen was davon ab. Die Menschen werden darauf geeicht, dass Autoritäten uns sagen können, was richtig und was falsch ist. Es werden Unterwürfigkeit und das Gefühl, dass man selber nicht in der Lage ist, in der Welt durchzublicken, systematisch herangezogen.
Dieser Charakterzug, diese Persönlichkeitsstrukturen sorgen eben dafür, dass die Menschen sagen: „Ja ok, wenn die das sagen, dann ist es wohl richtig.“ Oder wenn Ärzte eine Impfung empfehlen, ist das richtig. Wenn sie sagen, Russland ist gefährlich, wir müssen aufrüsten, dann stimmt das eben auch. Der Durchschnittsbürger nimmt es dann tatsächlich gar nicht wahr, traut sich nicht, es wahrzunehmen, weil die Autoritäten ja was anderes sagen. Diese autoritäre Erziehung ist in meinen Augen eines der größten Hindernisse, die Realität in ihrer Gefährlichkeit zu erkennen.
Da muss ich intervenieren. Zum einen gab es in Westdeutschland eine anti-autoritäre Erziehung, zum anderen sind diejenigen, die sich heute noch wehren, die Grauköpfe, also Menschen, die eigentlich einer noch eher autoritären Erziehung – im westdeutschen Sinne – unterworfen waren. Gerade das sind diejenigen, die heute aktiv sind. Bei Dir klingt es nach: Wir können ja gar nichts dafür, weil wir ja Opfer einer autoritären Erziehung geworden sind. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Fangen wir mit der anti-autoritären Erziehung an. Du kennst vielleicht den Satz: Das Gegenteil eines Fehlers ist wieder ein Fehler. Ich denke, der Satz trifft in der Regel zu.
Anti-autoritär ist nicht besser als autoritär. Das Wort anti-autoritär hat Alexander Neill, auf den sich die anti-autoritäre Erziehung berief, nie als Kennzeichnung seines Konzeptes akzeptiert. Als Ossi Jahrgang 1957 habe ich diese Art von Erziehung zwar nicht miterlebt, aber ich habe mit vielen gesprochen, die es betroffen hat und viel dazu gelesen. Anti-autoritär hat an die Stelle der alten Fehler neue Fehler gesetzt. Autoritär ist falsch, aber es gibt gesunde Autoritäten in dem Sinne, dass Kinder Halt, Struktur, Unterstützung und Förderung brauchen. Die anti-autoritäre Erziehung war teilweise wohl eher eine Pervertierung dessen, was Alexander Neill in Summerhill tatsächlich wollte.
Neill nannte es demokratische Erziehung. Er ging davon aus, dass Kinder nicht weniger wert sind als Erwachsene und alles, was Kinder selber beurteilen können, sollen sie auch demokratisch mitbestimmen. So lief es in der Schule von Summerhill. Anti-autoritär bedeutete dagegen oft, dass die Erwachsenen, die Eltern beschlossen, wir sind jetzt einfach die Kumpels unserer Kinder. Wir kommen mit euch in den Sandkasten und hauen uns gegenseitig die Schippe um die Ohren. Gesunde Autoritäten fehlten, dafür gab es grauhaarige Spielkameraden. Die anti-autoritäre Erziehung war also vielfach keine Verbesserung, sondern einfach eine andere Variante, Kinder nicht so zu behandeln, wie sie es brauchen. Daher konnte diese Erziehung wohl auch nur begrenzt zu gesünderen psychischen Strukturen bei den Heranwachsenden führen. Wie viele davon erreicht wurden, ist auch offen – und es flaute spätestens in den 90ern deutlich wieder ab.
Es hat sich in Richtung Helikopter-Eltern entwickelt – aber lass uns nicht weiter auf Kindererziehung eingehen, sonst führt es zu weit. Wie ist es mit den „Grauköpfen“? Die 60- bis 80-Jährigen waren einer klar autoritären Erziehung unterworfen. Und das sind die, die man noch im Widerstand auf der Straße findet.
Die Generationen-Problematik sehe ich genauso und das betrifft meines Erachtens Ossis wie Wessis. Ohne wissenschaftliche Statistik als Beleg: Auch ich habe den Eindruck, dass es im Osten vor allem Grauköpfe sind.
Warum ist es so?
Es gibt einen ganz entscheidenden Faktor, der vielen systemkritischen Menschen nicht bewusst ist. Das sozialistische Weltsystem – insbesondere die DDR – war für die BRD eine Konkurrenz, die vielfach dafür gesorgt hat, dass sich die BRD und der Westen insgesamt so attraktiv wie möglich darstellen wollten.
„Demokratie“, Meinungsfreiheit und Toleranz gegenüber anderen Auffassungen war meines Erachtens nicht zuletzt deswegen bis zur Maueröffnung größer als sie jetzt ist, weil man zeigen wollte: Wir sind das bessere System. Es war das Ziel, das andere System, das sozialistische, das als Gegner empfunden wurde, zu diskreditieren, letztlich zusammenbrechen zu lassen.
Die Grauköpfe, die in den 50er-, 60er-Jahren geboren sind, haben eine deutlich bessere Demokratie in der BRD erlebt als das, was in den letzten 20 Jahren der Fall ist. Wer nach der sogenannten Wiedervereinigung, also nach dem Anschluss der DDR, nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems, aufgewachsen ist, erlebte die zunehmende Tendenz zum Neoliberalismus. Wer nach 1990 aufgewachsen ist, lernte keine Alternative kennen und die frühere sozialistische Alternative, die sicherlich nicht ideal war, war diskreditiert. Man glaubt zu wissen, die DDR war totalitär, böse, es gab die Mauer, man durfte nicht reisen, Schluss, Punkt, aus.
Menschen wie du und ich und andere aus unserer Generation oder etwas vorher, haben das davor und danach bewusst erlebt. Wir wissen, dass es Alternativen gab, dass diese denk- und machbar sind.
Das kann ich nachvollziehen. Es begründet, warum unsere Generation etwas tut und die anderen nicht.
Die Jüngeren sehen keine Alternative, da sie mit keiner aufgewachsen sind. Selbst Menschen im Westen, die den Kommunismus ablehnten, hatten trotzdem mitgekriegt, dass es ihn gibt. Da war eine Alternative und diese behauptete von sich, sie sei besser. Und wenn man nicht völlig ideologisch manipuliert war, hat man mitbekommen, dass es zumindest einzelne Aspekte gab, wo „die drüben“ wirklich besser oder zumindest anders waren. Und das ist allen, die ein paar Jahre vor 1990 auf die Welt gekommen sind, kaum noch bewusst.
Der Kapitalismus wird seitdem als alternativlos dargestellt. Wenn das so ist, dann liegt der Gedanke nahe: Ich muss mich dem System eben anpassen, mich darin einrichten. Und das auch geistig, sonst gehe ich ja kaputt. Um mich einzurichten, um nicht ständig anzuecken, muss ich die geltenden Normen übernehmen. Das lerne ich üblicherweise in der Kindheit, von den Eltern und in der Schule.
Wenn der Kapitalismus meine einzige Option ist, werde eben auch ich psychisch kapitalistisch – das kann ich nachvollziehen. Aber weg von der Analyse, hin zur Lösung. Wie erreicht man Menschen trotz dieser Barrieren? Mit Fakten erreicht man sie kaum. Am besten wohl mit Emotionen, positiv oder negativ. Aber ist es sinnvoll, nur über Emotionen zu arbeiten?
Ich sehe es nicht so negativ wie Du, ich würde Emotionen und Rationales überhaupt nicht trennen wollen.
Menschen, die sehr auf die geltenden herrschenden Normen fixiert sind, die erreichst Du wahrscheinlich weder rational noch emotional. Die sind nicht nur im Denken behindert, obwohl sie ja nicht doof sind, sondern haben Angst, bestimmte Sachen auch nur zu sehen. Das ist die rationale Komponente. Diese Menschen haben aber auch Angst, bestimmte Sachen zu fühlen. Du kommst also auch nicht emotional an sie ran.
Man kann Menschen durchaus unter Umständen sowohl rational als auch emotional erreichen. Ich weiß auch durch meine psychotherapeutische Tätigkeit, dass beides geht, und zwar lebenslang. Aber dazu benötigen sie zumeist etwas, was Leidensdruck genannt wird, zum Beispiel wenn sie aufgrund einer Krise ihr Leben in Frage stellen und verändern wollen.
Das ist für mich momentan ein entscheidender Punkt. Die westlichen Regierungen tun alles, um uns in Krisensituationen zu bringen, und zwar nicht nur gesellschaftlich, sondern auch individuell. So entsteht bei immer mehr Menschen Leidensdruck und damit entsteht auch die Möglichkeit, dass man sie eventuell erreichen, auffangen, abholen kann in ihrem Leid, dass sie offen sind, nach besseren Alternativen zu suchen.
Anders gesagt: Wenn es so weitergeht, werden notgedrungen immer mehr Menschen mit ihrem Leben unzufrieden sein müssen oder auch daran tatsächlich verzweifeln. Das ist sehr bitter für den Einzelnen, es schafft aber gleichzeitig eine Situation, in der Menschen objektiv offener sein könnten für Veränderungen. Ob sie das wirklich umsetzen, ist eine andere Frage, aber in der Krise liegt eben immer eine Chance.
Böse auf den Punkt gebracht: Lasst endlich einen Krieg ausbrechen, damit die Menschen begreifen, dass sie was verändern müssen?
Nein, ganz bestimmt nicht. Ein Krieg schafft mit Sicherheit erstmal nur negative Veränderungen. Menschen verhärten, kämpfen nur noch ums Überleben und sind ganz bestimmt nicht offen für psychotherapeutische oder Aufklärungsangebote. Ein Krieg ist ganz sicher nicht hilfreich für positive Veränderungen.
Krieg meine ich ganz sicher nicht. Aber vieles, was das westliche System zumindest in Deutschland über Jahrzehnte relativ attraktiv gemacht hat, wird gerade kaputt gemacht. Nicht zuletzt eine relativ freie Meinungsäußerungsmöglichkeit. Der Konsum wird durch steigende Preise, Jobverluste und Inflation auch eingeschränkt. Ebenso die Reisefreiheit, also Reisemöglichkeiten – weil es zu teuer ist, weil es zu beschwerlich ist – zum Beispiel nach Russland zu kommen –, aber auch weil es aufgrund von Krieg und Bürgerkrieg zu gefährlich ist.
Das Leben hier im Westen wird immer unattraktiver, viele Lebenslügen zerplatzen ebenso wie die Zukunftschancen der nachfolgenden Generationen. „Meinen Kindern wird es mal besser gehen als mir“ – danach sieht es überhaupt nicht mehr aus.
Definitiv nicht. Viele Menschen werden ja durch Angst gesteuert. Wäre es in Deinen Augen sinnvoll, diese Ängste für „unsere“ Sache zu nutzen?
Was meinst Du, wie stellst du dir das vor?
Wenn Ängste zu Handlungen führen – man hat ja gesehen, wie viele aus Angst vor einem Virus in die Spritze gerannt sind –, könnten wir viel stärker mit den Folgen von Krieg argumentieren. Mit dem Hinweis auf Kriegsfolgen könnte man Ängste schüren, damit die Menschen sich endlich für Frieden auf der Straße einsetzen. Heute ist man ja schon froh, wenn auf einer Friedensdemo 5000 Teilnehmer gesehen werden. In den Zeiten des Bonner Hofgarten waren wir zwischen 300.000 und 500.000, je nachdem, wessen Zählung man glaubt. Sollte man den Menschen nicht wirklich mal ein paar verstümmelte Opfer direkt vors Gesicht halten und sagen: „Du schaust bald so aus, wenn du nichts tust.“?
Die letzte Frage würde ich bejahen. Beim Umgang mit Ängsten würde ich das wieder unbedingt differenzieren wollen.
Menschen, die autoritär erzogen worden sind, sind immer geprägt von vielfach unbewussten Ängsten vor Autoritäten, also neurotischen, irrealen Ängsten. Diese Ängste sollte man natürlich nicht noch verstärken. Sie führen ja auch nicht zu sinnvoller Aktivität, eher zu Lähmung. Gerade neurotische Ängste suggerieren oftmals: „Ich kann sowieso nichts daran ändern, ich bin klein und doof, abhängig und hilflos.“ Das ist ja in keiner Weise hilfreich.
Dagegen brauchen wir Ängste, die eine reale Grundlage haben, zum Überleben, für unsere Orientierung, die sind ganz ganz wichtig. Deswegen geht es nicht darum, Ängste zu schüren, sondern real vorhandene Bedrohungen zu benennen. Man sollte den Menschen die tatsächlichen Bedrohungen nahebringen, damit sie aufhören, ihre berechtigten Ängste davor zu verdrängen.
Viele haben zum Beispiel den ausgesprochen realitätsfernen Gedanken, unsere Regierung weiß schon, was sie macht, die werden schon das Richtige für uns tun. Da gilt es stattdessen reale Ängste zuzulassen: Um Himmels willen, was tun die da jetzt schon wieder?!
Ein Phänomen, das mich manchmal zur Verzweiflung treibt: Warum verbringen die Menschen so viel Zeit in (a)sozialen Medien, liken, teilen, kommentieren, tun aber nichts konkret? Der virtuelle Stammtisch ist in meinen Augen fast noch sinnloser als der Kneipen-Stammtisch. Hast du da eine Erklärung dafür?
Mit asozialen Medien meinst Du ...?
Facebook, Telegram, Instagram, X, aber auch Blogs und Online-Medien mit Kommentarspalten.
Da kann ich insofern nur begrenzt mitreden, weil ich nichts davon nutze. Ich besitze nicht mal ein internetfähiges Handy.
Für mich hat es zwei Aspekte. Die intensive, meiner Meinung nach oftmals suchtartige Mediennutzung ist aus meiner Sicht die Folge der Isolierung, die diese Gesellschaft mit uns vornimmt. Das macht sie auf verschiedene Weise. Sie entsolidarisiert und betont in einer fast perversen Weise das Individuelle und unterdrückt, vernachlässigt oder diffamiert das, was uns verbindet.
Was dabei rauskommt, sind Leute, die sich für einzigartig halten, aber gleichzeitig enormen Bedarf haben, sich doch zu verbinden, aber ohne echte Nähe, mitsamt Konfrontation, Kritik, Selbstkritik, Austausch und Veränderung zuzulassen. Für so strukturierte Menschen sind diese Medien doch perfekt. Also das wäre die Antwort auf die Frage, warum überhaupt diese Mediennutzung.
Dass viele die Regierungs-, Coronamaßnahmen- und aufrüstungskritischen Medien benutzen und sich auch irgendwie äußern, ist ja an sich wiederum erstmal positiv. Denn es zeigt, dass doch ein geändertes Bewusstsein da ist, größer als es bisher je war.
Von da aus ins sinnvolle Handeln zu kommen, ist ja noch mal ein Riesenschritt, denn je mehr man tut, desto riskanter wird es. Hier und da eine Unterschrift zu leisten geht noch, aber dann den Kopf noch weiter aus dem Fenster zu lehnen, noch deutlicher zu machen: „Hier bin ich und ich habe diese Meinung“ – da kommen Ängste hoch.
Dass davor auch eine ganz reale Angst besteht, verstehe ich. Es wäre nur wichtig, dies abzuwägen gegen die andere reale Angst: davor, was kommt, wenn wir nichts tun. Wenn wir uns nicht zusammentun, uns erheben und Widerstand leisten, haben wir vielleicht noch ein paar Wochen, Monate oder Jahre ein relativ bequemes, relativ wohlhabendes Leben, aber dann fallen uns vielleicht auch hier die Bomben auf den Kopf, oder wir werden zwangsgeimpft oder, oder, oder. Was weiß ich.
Das können die meisten wohl noch nicht. Da wäre eine Psychotherapie vermutlich hilfreich, aber das würde jetzt zu weit führen. Darum zum Abschluss meine Frage: Wie wird man den Satz los: „Ich als Einzelner kann nichts tun.“?
Als Einzelner isoliert werde ich sicherlich nicht viel erreichen. Diesen Teil kann man nur bekräftigen.
Aber wenn ich nicht bei mir anfange, wenn ich mich nicht mit mir selber konfrontiere, wenn ich nicht hinterfrage, wie weit ich dieses System, unter dem ich leide, absichtsvoll oder unbeabsichtigt unterstütze, dann kann ich gar nichts ändern.
Die Regierung kann ich nicht von heute auf morgen verändern. Dazu muss ich mich mit anderen zusammentun. Aber mich selber zu fragen: „Warum leiste ich keinen Widerstand, warum will ich gar nicht erkennen, was wirklich los ist?“, ist sofort möglich. Diese Fragen kann ich mir stellen, auch wenn die Antworten Verunsicherung oder Angst hervorrufen. Aber da muss ich dann durch.
Eines meiner Lieblingszitate von Wilhelm Reich ist: „Versucht man die Struktur der Menschen allein zu ändern, so widerstrebt die Gesellschaft. Versucht man die Gesellschaft allein zu ändern, so widerstreben die Menschen. Das zeigt, dass keines für sich allein verändert werden kann.“
Eine wirklich grundlegende und nachhaltige Veränderung geht also nur in einer Kombination von beiden?
Ja. Also der Einzelne muss sich mit sich und mit seinem direkten Umfeld beschäftigen, darf dabei aber nicht stehen bleiben, sondern muss dann die Kraft daraus schöpfen, um gemeinsam mit anderen die Gesellschaft zu verändern.
Dann hoffe ich, dass möglichst viele Menschen bereit sind, sich auf diese Auseinandersetzung mit sich selbst einzulassen, damit wir irgendwann genügend Aktive sind, die eine andere Gesellschaft gestalten. Ich danke Dir für Deine Zeit!
Dieses Interview war in Teilen eher ein Gespräch als Interview – und wir überlegen, dieses Gespräch zwischen Ossi und Wessi in irgendeiner Form weiterzuführen. Von daher: Fortsetzung folgt!
Andreas Peglau war auch zu Gast bei apolut "Im Gespräch": https://apolut.net/im-gespraech-andreas-peglau/
+++
Wir danken der Autorin für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: ein Mensch bricht frei
Bildquelle: Alberto Andrei Rosu / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut