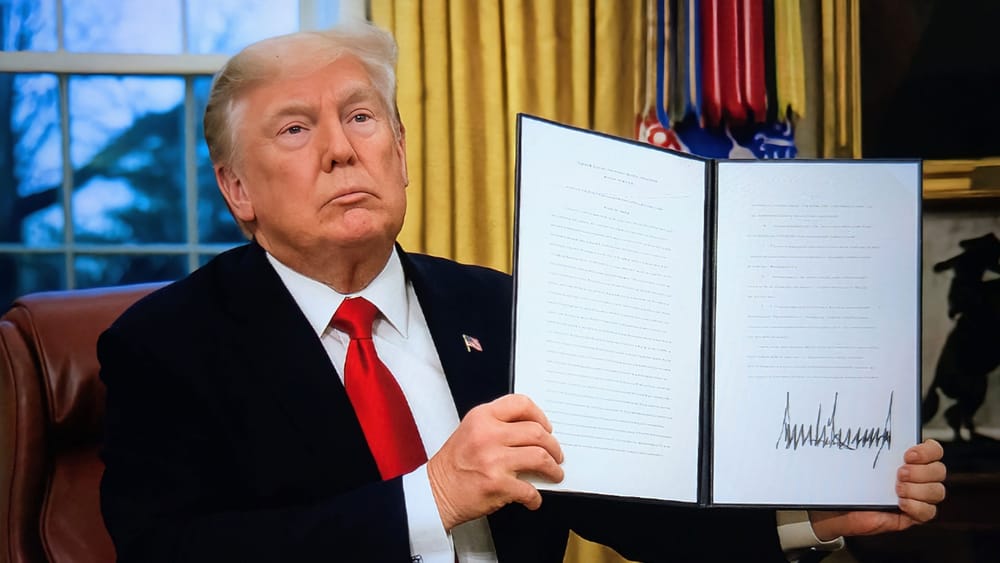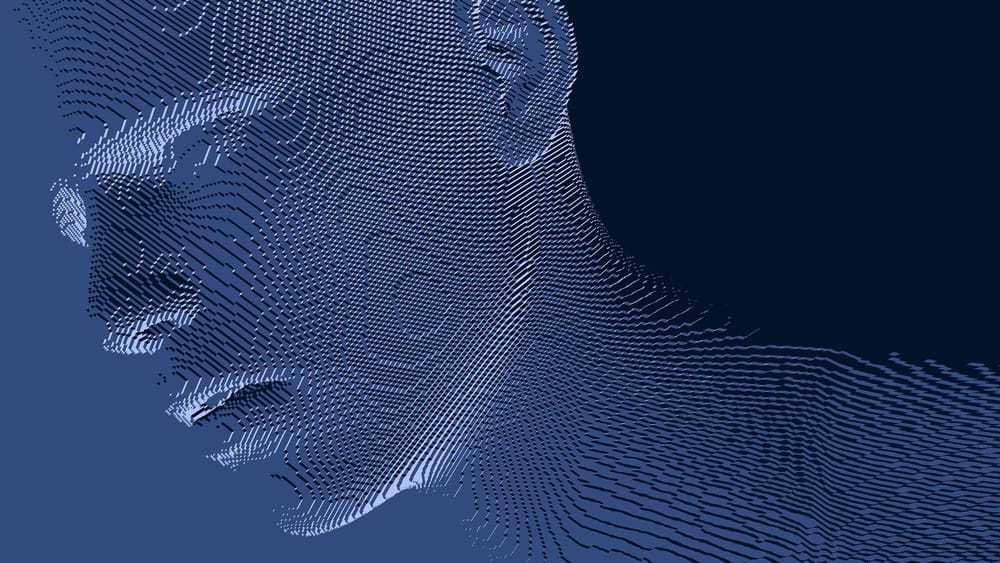“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Wüste steht für existenzielles Minimum. In ihr betritt der Mensch lebensfeindlichen Raum. Psychischer und physischer Bedarf? Wird bis unter die Schmerzgrenze reduziert. Unterschlupf? Ablenkung? - Fehlanzeige. Gewohnheiten? - Schmelzen im Sekundentakt.
In diesem Feuerofen erscheint selbst Wind als heißer Atem. Langfristig überleben hier lediglich Nomadenstämme. Menschen, die wissen, wo die Oasen versteckt sind, vor welchen Giftschlangen man ausweicht, welches Wasser verseucht und welche Wüstenstadt bloße Fata Morgana ist. Ohne dieses Wissen, ohne inneren Kompass, verschlingt die Wüste den Eindringling.
Hierhin zogen die Christen der Spätantike. Bereits Johannes der Täufer war Wüsten-Eremit und Jesus setzte sich ihr 40 Tage aus. Als im antiken Rom der spirituelle Ausverkauf begann, lockten öde Sandberge als Stätten der Zuflucht. Als Meditationsraum für Sinnsucher, der zum Wesentlichen zwingt. Die Vorschriften der Mächtigen: Hier haben sie keinerlei Gültigkeit mehr. Überfluss, Gewinn und Komfort: Verliert jegliche Bedeutung. Und Flüchtende sind dort relativ geschützt. Der Glutofen aus Sand schreckt die Verfolger.
Und heute? Hat die Wüste als Ort des Rückzugs, der spirituellen Grenzerfahrung ausgedient? Oder könnte ihr als Ort der Zuflucht ein Comeback gelingen? Als Rettungsareal vor kommenden Katastrophen? Elon Musk beispielsweise plant: Wird die Erde unbewohnbar, müssen Cyborgs den Mars besiedeln. Dessen Oberfläche: Nichts als roter Sand. Ein Wüstenplanet. Einige Nummern kleiner versucht es Regisseur Óliver Laxe. Sein vierter Spielfilm „Sirāt“ läuft derzeit in bundesdeutschen Kinos. Der spielt während des dritten Weltkriegs. Ein „Mad Max“ für Arthouse-Fans.
Es beginnt mit einer Rave-Party, am Rande der marokkanischen Wüste. Das Jungvolk tanzt sich in Ekstase. Da taucht ein älterer Mann auf. Mit ihm: Der zwölfjährige Sohn Esteban. Beide haben ein Ziel: Luis verschollene Tochter zu finden. Er lässt Fotos von ihr rundgehen. Keiner kennt sie. Plötzlich stürmt das Militär herbei: Sämtliche Ausländer sollen das Land verlassen. Im eigenen Interesse. Es herrscht nämlich Krieg. Wieder einmal. Und diesmal weltweit. Grund? Wird nicht erwähnt. Ist auch unwichtig. Jeder Kriegsgrund ist Vorwand.
Einige Raver flüchten mit zwei LKWs. Luis und Estaban folgen ihnen im Van. Ziel: Jenseits des Atlas-Gebirges, am Rande Marokkos, soll ein weiterer Wüsten-Rave stattfinden. Eine winzige Chance für Luis, die Verschollene dort zu finden. Außerdem: Wo soll er hin? Während eines Weltkrieges ist jeder Ort suboptimal.
Die Raver sind von dem älteren Begleiter wenig erbaut. Aber die Härten des Gebirges verlangen Zusammenhalt. Ein Prozess der Annäherung beginnt. Sie begegnen einem Nomaden, der sich vor den Ravern fürchtet. Die Wüste und seine Bewohner sind zeitlos. Trends, Moden, Hightech, Jagd nach Aktualität – all das hat hier keinen Platz. Der Krieg scheint weit weg, nur noch über Radiomeldungen präsent. Sorgt kaum für Gesprächsthemen.
Dann der Schicksalsschlag: Als ein LKW feststeckt, versucht Luis zu helfen, lässt seinen Sohn im Van zurück. Da löst sich die Handbremse. Der Van rollt rückwärts, stürzt in die Schlucht. Estaban mit ihm. Welch grausige Ironie: Luis war in die Wüste gegangen, um die verschwundene Tochter zu suchen. Und verlor dabei noch den Sohn. Hatte das Roadmovie „Sirāt“ bislang eine gewisse Leichtigkeit: Ab dem Moment ist sie vorbei. Unwiderruflich.
Am Ende werden die Raver wieder eingeholt - von dem Krieg, dem sie entkommen wollten. Vor dem sie in Drogen- und Tanzrausch geflüchtet waren. Ahnungslos fahren beide LKWs ins Minengebiet. Sie halten, drehen die Musik auf laut | und tanzen im heißen Sand. Bis es kracht. Bis eine Kriegsmine den ersten Körper zersprengt...
Das postapokalyptische Kino wies der Wüste eine neue Bedeutung zu: In Filmen wie „Mad Max“ ist der Atomkrieg bereits gelaufen, ist die Welt längst pasteurisiert. Ist alles Wüste. „Sirāt“ hingegen präsentiert sie erneut als Fluchtort. Aber nicht lange.
Bald zeigt sich: Sie kann diese Funktion nicht mehr erfüllen. Dem 21. Jahrhundert entkommt man nur kurzfristig. Der globale Krieg verfolgt die Flüchtenden bis zum letzten Winkel. „Sirāt“ verzichtet auf klassische Dramaturgie, auf Spannungsbögen und Helden. Hier ist niemand stoisch-stark, hier gibt es keine mutigen Taten, keine Selbstopferung. Hier wird geflüchtet und verzweifelt. Die Protagonisten sind fern jeglicher Selbstinszenierung. Keiner versucht, irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen.
Regisseur Óliver Laxe erklärte im Interview: Die Wüsten-Raver „zeigen ihre Narben und tragen ihre Wunden offen mit sich. Klar, sie haben ihre Widersprüche und ihre Schwächen, wie wir alle. Aber ich sehe das eher als ein Zeichen von Reife. In unserer Gesellschaft, insbesondere in den westlichen Ländern, sind wir ständig damit beschäftigt, ein idealistisches Bild von uns selbst zu konstruieren. Wir glauben wirklich, dass wir fitte, ausgeglichene Menschen sind. Aber wenn man ein wenig in der Welt herumreist, versteht man, dass die meisten von uns psychisch ziemlich angeschlagen sind.“
„Sirāt“ ist Laxes vierter Kinofilm. Was den Franzosen von früheren Starregisseuren seiner Heimat unterscheidet: Egal, ob Renoir, Godard, Truffaut, Chabrol oder François Ozon - deren Filme spielen in Paris, in Cafés, allenfalls in einer südfranzösischen Ortschaft.
Anders bei Laxe: Aufgewachsen in Frankreich, Spanien und Marokko, zeigt er am städtischen Leben kaum Interesse. Ebenso wenig an Upper Class-Diskursen.
Die Wüste hingegen thematisierte Laxe bereits vor sechs Jahren, in dem Film „Feuer wird kommen“. Der spielt in einem spanischen Dorf, umgeben von üppiger Vegetation. Plötzlich verwandelt ein gigantischer Waldbrand alles in eine verkohlte Ödnis. Eine Umkehrung von „Sirāt“: Die Menschen gehen nicht in die Wüste, sondern umgekehrt: Die Wüste kommt zu ihnen.
Der Titel „Sirāt" entstammt dem Arabischen und bezeichnet eine hauchdünne Brücke zwischen Leben und Tod. Aber der Film ist kein Runterzieher. Gerade weil er aufs Ganze geht, ist er laut dem Regisseur auch ein „metaphysisches Abenteuer“, sogar „religiös“. Das Wort „Religion“ bedeutet so viel wie „Rückbindung“. Genau die suchen die Raver in einem Moment, wo die Welt zugrunde geht. Tatsächlich interpretiert Laxe die LKWs als „Raumschiffe“, die Wüste als Weltall. Endlose Weiten, ohne Wiederkehr.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bild: steinige Wüste mit tiefer Sonne
Bildquelle: Lubo Ivanko/ shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut