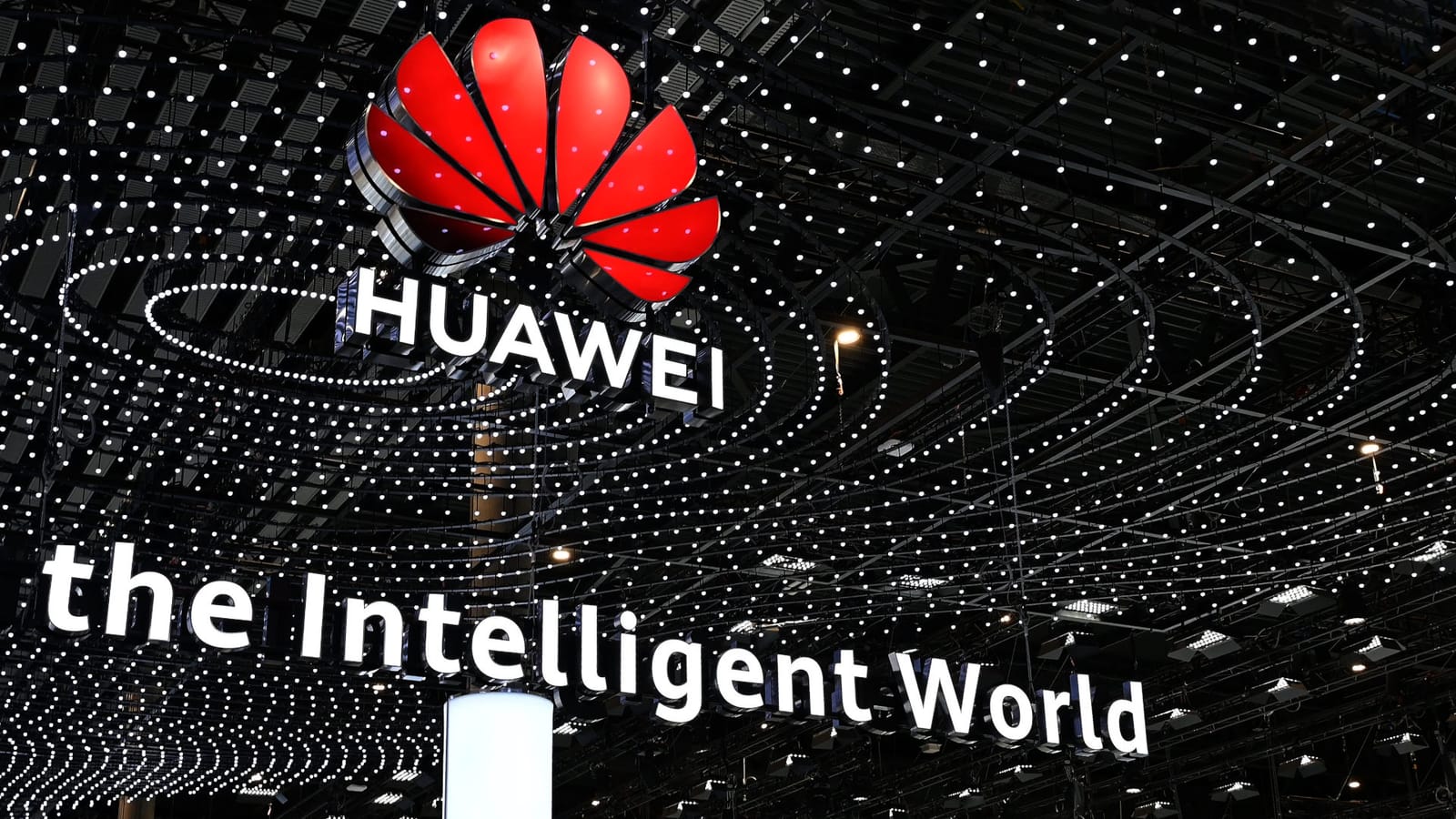Der Krieg des mächtigsten Staates der Welt gegen ein chinesisches Privatunternehmen
Die Vereinigten Staaten haben sich lange Zeit als Verfechter des freien Marktes und des fairen Wettbewerbs dargestellt – allerdings nur, wenn sie die Oberhand hatten. Diese Ära ist vorbei.
Ein Meinungsbeitrag von Felix Abt.
Von Toshiba bis zu Huawei: Amerikas langer Krieg gegen überlegene Wettbewerber
Die Vereinigten Staaten haben sich lange als Verfechter freier Märkte und fairen Wettbewerbs dargestellt — aber nur, solange sie die Oberhand hatten. Diese Ära ist vorbei. Oligarchen wie Peter Thiel, eine Schlüsselfigur des US-Sicherheitsapparats und Gründer von Palantir — dem weltweit umfassendsten, mit Steuergeldern finanzierten Überwachungs- und Profiling-Unternehmen, entwickelt mit der CIA — argumentieren offen, dass Wettbewerb „schlecht für das Geschäft“ sei. Thiel stellt Wettbewerb dem Monopol gegenüber, das er erstaunlicherweise als wahren Treiber von Innovation und Profit bezeichnet.
In Wirklichkeit war Washingtons Engagement für freie Märkte immer nur ein Lippenbekenntnis. Die USA haben konsequent versucht, überlegene Wettbewerber ihrer großen Unternehmen zu zerschlagen. Wirtschaftskrieg ist nichts Neues.
Nehmen wir Toshiba: Laut einem Artikel der Los Angeles Times vom August 1992 war der Konzern in den 1980er Jahren Japans führender Chiphersteller und beherrschte 1987 etwa 80 % des globalen Marktes für dynamischen RAM (DRAM). Wie Huawei heute wurde Toshiba unter dem Banner der „nationalen Sicherheit“ zum Ziel der USA. Nachdem Toshiba und ein norwegisches Unternehmen 1986 fortschrittliche Fräsmaschinen an die Sowjetunion verkauft hatten – wie es auch andere europäische Unternehmen taten – schlug Washington zu. Es verhängte ein umfassendes Zwei- bis Fünfjahresverbot für alle Toshiba-Produkte mit der Begründung einer Bedrohung der US-Sicherheit. Dieser Schlag ebnete den Weg für amerikanische Chiphersteller, während andere ausländische Unternehmen, die ähnliche Ausrüstungen an die UdSSR verkauft hatten, ungeschoren davonkamen.
Oder betrachten wir Alstom, einst als „Juwel der französischen Industrie“ gepriesen. Ein Weltmarktführer in der Energie- und Verkehrstechnologie, trat er in den frühen 2010er Jahren direkt gegen den US-Riesen General Electric (GE) an. Dann kam Washingtons Schlag: 2013 wurde Alstom-Manager Frédéric Pierucci – Autor von „The American Trap“ – am Flughafen New York unter umstrittenen Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit einem Vertrag in Indonesien festgenommen. Pierucci erinnerte sich, dass ihm eine drakonische Wahl angeboten wurde: schuldig bekennen und innerhalb weniger Monate freikommen oder 125 Jahre Haft riskieren. Mehrere Alstom-Führungskräfte wurden ebenfalls festgenommen, und US-Gerichte verhängten eine Geldstrafe von 772 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser Form der Nötigung und des unaufhörlichen juristischen Drucks sah sich Alstom 2014 gezwungen, seine Kernbereiche Energie und Netz an GE zu verkaufen, wodurch ein bedeutender europäischer Wettbewerber effektiv zerschlagen wurde.
Das Muster wiederholt sich anderswo. Unter massivem US-Druck wurde die Schweiz gezwungen, das Bankgeheimnis und ihre anonymen Nummernkonten abzuschaffen, die lange Zeit ein Eckpfeiler ihrer Finanzindustrie waren. Währenddessen unterhielten US-Bundesstaaten stillschweigend ihr eigenes System anonymer Briefkastenfirmen, wodurch Amerika zum weltweit größten Zufluchtsort für Geldwäsche und Steuerhinterziehung wurde. Es wurde zum bevorzugten Rückzugsort für lateinamerikanische Drogenkartelle, um ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne sicher zu verbergen.
Offshore-Finanzzentren in Panama, Singapur und der Karibik wurden von Leaks und Skandalen erschüttert – aber nie US-Institutionen. Das war kein Zufall: Die NSA und andere US-Spionageagenturen zielen auf ausländische Banken ab, nicht auf amerikanische.
Ob Toshiba, Alstom oder Schweizer Banken – die Geschichte ist dieselbe: Washington macht „Recht und Gesetz“, „Sicherheit“ und „Ethik“ zur Waffe, um Rivalen zu eliminieren, und übernimmt dann die Praktiken, die es im Ausland verurteilt.
Doch Huawei – und damit China – ist ein anderes Kaliber. Im Gegensatz zu Japan, Frankreich oder der Schweiz kann China nicht leicht in die Knie gezwungen werden. Im Gegenteil, die US-Kampagne gegen Huawei wird viel wahrscheinlicher nach hinten losgehen und sich zu einer entscheidenden Niederlage für die westlichen Aggressoren entwickeln – wie der Rest dieses Artikels zeigen wird.
Das wirtschaftliche Schlachtfeld: Wie die USA Huawei angriffen
Vor dem 29. August 2023 hatte die Welt fast filmreife Angriffe erlebt: Die Vereinigten Staaten, die mächtigste Nation der Erde, führten einen Wirtschaftskrieg gegen ein einziges privates Unternehmen. Huawei, ein aufstrebender globaler Telekommunikationsriese, sah sich verheerenden Sanktionen, lähmenden Lieferkettenblockaden, unaufhörlichen Rechtsstreitigkeiten und der hochkarätigen Festnahme der Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada aufgrund weitgehend unbegründeter Anschuldigungen gegenüber. Länder weltweit wurden massiv unter Druck gesetzt, Huawei aus 5G-Netzen auszuschließen, und das Unternehmen wurde offiziell als „nationale Sicherheitsbedrohung“ eingestuft. Für Außenstehende schien Huawei am Ende.
Dann kam der 29. August 2023. Still und leise, ohne großes Aufsehen, listete Huawei das Mate 60 Pro auf seiner Website. Zunächst waren Tech-Experten verwirrt, dann schockiert, schließlich ungläubig. In diesem eleganten Smartphone steckte der Kirin 9000S – ein 7-Nanometer-System-on-a-Chip mit voller 5G-Fähigkeit. Für Außenstehende war es nur ein Chip. Für diejenigen, die den US-chinesischen Technologiekonflikt verfolgten, war es eine Erklärung: Huawei hatte nicht nur überlebt – sie hatten zurückgeschlagen. Das Mate 60 Pro verkaufte sich in China über 14 Millionen Mal und verband technologischen Triumph mit patriotischem Stolz.
Aus der Asche empor: Huaweis Weg zum nationalen Champion
Der Wirtschaftskrieg gegen Huawei und andere chinesische Unternehmen hat in China eine Welle patriotischen Konsums ausgelöst. Viele Verbraucher wenden sich von westlichen Produkten ab und bevorzugen heimische Marken, unterstützen lokale Innovationen, stärken inländische Industrien und verstärken Chinas Bestrebungen nach technologischer Unabhängigkeit.

Der unermüdliche Ingenieur, der Huawei formte: Vom harten Beginn zur globalen Spitze
Ren Zhengfei, der Gründer von Huawei, war kein gewöhnlicher CEO. Geboren 1944 im ländlichen Guizhou, überstand er die Kulturrevolution, die Inhaftierung seines Vaters und erhebliche frühe Widrigkeiten. Seine Philosophie des chī kǔ – „Bitterkeit essen“ – wurde zu Huaweis Leitprinzip.
Nach Jahren im Ingenieurkorps der Volksbefreiungsarmee zog Ren 1987 nach Shenzhen und gründete Huawei mit nur 21.000 Yuan (~5.000 US-Dollar). Anfangs ein Wiederverkäufer von PBX-Schaltern, setzte Huawei schnell auf Reverse Engineering und Selbstgenügsamkeit. 1993 bewies der erste selbst entwickelte digitale Schalter, dass Überleben technologische Unabhängigkeit erforderte.
Von der Wolfsmentalität zur globalen Dominanz
Rens militärisch inspirierte „Wolfskultur“ befeuerte Huaweis globalen Aufstieg. Anstatt direkt mit westlichen Giganten zu konkurrieren, eroberte das Unternehmen unterversorgte Märkte in Afrika, Lateinamerika und Russland mit aggressiven Preisen, flexibler Finanzierung und außergewöhnlichem Service. Mitte der 2000er Jahre hatte Huawei Partnerschaften mit 31 der weltweit 50 größten Telekommunikationsanbieter geschlossen. Das Unternehmen expandierte dann in die Unterhaltungselektronik, lancierte die Ascend-, Mate- und P-Serien sowie eigene Kirin-Chips. Bis 2018 hatte Huawei Apple in China überholt und Samsung weltweit herausgefordert – was zu intensiver US-Kontrolle und Sanktionen führte.
In chinesischen U-Bahnen tragen Kinder und Mütter zunehmend Smartwatches – ein sichtbares Zeichen, wie rasant Huawei aufgeholt und Apple als Marktführer abgelöst hat. Und während Huawei bereits mit Smart Glasses die Zukunft einläutet, wartet die Welt noch immer auf Apples ersten Schritt in diesem Segment.
Projekt „DELETE AMERICA“: Der Überlebensweg
Mit dem internationalen Smartphone-Verkauf lahmgelegt, initiierte Huawei intern die kühne Strategie „Projekt DELETE AMERICA“ – ein systematisches Entfernen US-amerikanischer Technologie aus dem eigenen Ökosystem. HarmonyOS ersetzte Android, Huawei Mobile Services traten an die Stelle von Google-Apps, und die heimische Chipproduktion wurde massiv beschleunigt. Das Mate 60 Pro und der Kirin 9000S wurden zu ultimativen Symbolen dieses Comebacks – ein klarer technologischer Mittelfinger gegen die US-Blockade.
Von Smartphones zu mehr: Huaweis breite Diversifikation
Huaweis Ambitionen gehen weit über Telefone hinaus. Seine Cloud-Dienste konkurrieren mit globalen Marktführern, KI-Chips und große Sprachmodelle treiben Innovationen der nächsten Generation voran, und intelligente Automobil-Lösungen versorgen Smart Vehicles von Unternehmen wie SERES und Chery. IoT- und industrielle Automatisierungslösungen modernisieren Häfen und kritische Infrastrukturen. Huawei ist mehr als ein Smartphone-Unternehmen – es ist ein diversifiziertes Technologie-Kraftwerk, das ganze Industrien transformiert und befeuert und westliche Zwangsmaßnahmen in einen Katalysator für Innovation verwandelt.

In seinen Geschäften präsentiert Huawei nun Smartphones, Wearables und neue Autos voller intelligenter Technologien – von fortschrittlichem Infotainment und Konnektivitätsfunktionen bis hin zu Lösungen für autonomes Fahren – und zeigt damit die Expansion des Unternehmens über Unterhaltungselektronik hinaus in den Automobilbereich.

Huawei bietet zudem ein umfassendes Paket an Cloud-Diensten an – darunter KI-Computing, Datenspeicherung, Cybersicherheit und Unternehmenslösungen – unterstützt von einem Full-Stack-Ökosystem, das Telekommunikationsinfrastruktur, maßgeschneiderte Chips, Edge-to-Cloud-Plattformen und KI-Innovationen umfasst.
Der Preis des Comebacks
Die Wiederbelebung hatte ihren Preis. 2024 erreichte der Umsatz 120 Milliarden US-Dollar, aber der Nettogewinn fiel um 28 %. Forschung und Entwicklung verschlangen über 20 % des Umsatzes, und 67 % der Geschäfte konzentrierten sich auf China, was das Unternehmen anfällig für inländische Nachfrageschwankungen machte. Technologische Lücken bleiben bestehen – SMICs 7-nm-Chips hinken TSMCs 3-nm- und 2-nm-Prozessen hinterher. Doch Huaweis Ingenieure, ihre Innovationskraft und ihr unerschütterlicher Wille deuten an: Weitere Überraschungen sind nur eine Frage der Zeit.
Hinter den Bäumen, aber nicht hinter seinen Konkurrenten, ist Huaweis F&E-Zentrum in Shenzhen ein zentraler Innovations-Hub, Heimat von Tausenden Ingenieuren und Wissenschaftlern, die an 5G, KI, Halbleitern und Cloud-Technologien arbeiten. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – globaler Sanktionen und Lieferkettenblockaden investiert Huawei weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung – über 20 Milliarden US-Dollar jährlich – und bleibt so wettbewerbsfähig mit westlichen Technologieriesen und übertrifft diese in mehreren Bereichen bereits.
Geopolitische und reputationsbezogene Hürden bestehen weiterhin. Europäische Untersuchungen, darunter die Untersuchung in Brüssel 2025, sowie Huaweis Ausschluss aus Branchenverbänden verdeutlichen den anhaltenden Widerstand des Westens. Trotzdem hat Huawei den chinesischen Markt zurückerobert und expandiert kontinuierlich in die Märkte der Zukunft – jene Regionen, in denen die globale Mehrheit lebt, im Gegensatz zum wirtschaftlich schrumpfenden Westen.
Huaweis Aufstand: Technologie, Mut und der Niedergang des Westens
Huaweis Wiederaufstieg ist legendär: Ein privates Unternehmen, das trotz unaufhörlicher Angriffe des mächtigsten Staates der Welt mit kühner und unerschrockener Innovation alle Erwartungen übertrifft. Das Mate 60 Pro und der Kirin 9000S sind mehr als nur Geräte – sie sind Erklärungen von Widerstand, Einfallsreichtum und unerschütterlichem Trotz. Und seine Durchbrüche in mehreren Technologien verstärken nur Huaweis Position als globale Macht, mit der gerechnet werden muss.
Die Botschaft ist klar: China wird Einschüchterung oder Demütigung nicht länger dulden. Es setzt seine technologische Stärke und Souveränität durch und warnt den Westen, dass Unterschätzung teuer zu stehen kommen kann.
Die Einsätze gehen weit über Huawei hinaus. Chinas riesige, wohlhabende und schnell wachsende Mittelschicht – die größte der Welt – steht in krassem Gegensatz zur schrumpfenden, hochverschuldeten Mittelschicht der USA. Diese demografische und wirtschaftliche Realität positioniert chinesische Unternehmen – ebenso wie Firmen im Globalen Süden – dafür, die nächste Ära der globalen Märkte zu gestalten, während westliche Konzerne stagnieren oder zurückfallen.
Huaweis Weg dient als Weckruf: Das Gleichgewicht der technologischen und wirtschaftlichen Macht verschiebt sich, die westliche Dominanz schwächelt, und die Politik, die China eindämmen sollte, hat unbeabsichtigt ihren eigenen Niedergang beschleunigt.
+++
Dieser Beitrag erschien zuerst am 18. September 2025 auf forumgeopolitica.com.
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Huawei-Logo auf Mobile World Congress 2025 in Spanien
Bildquelle: Joana Stock / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut