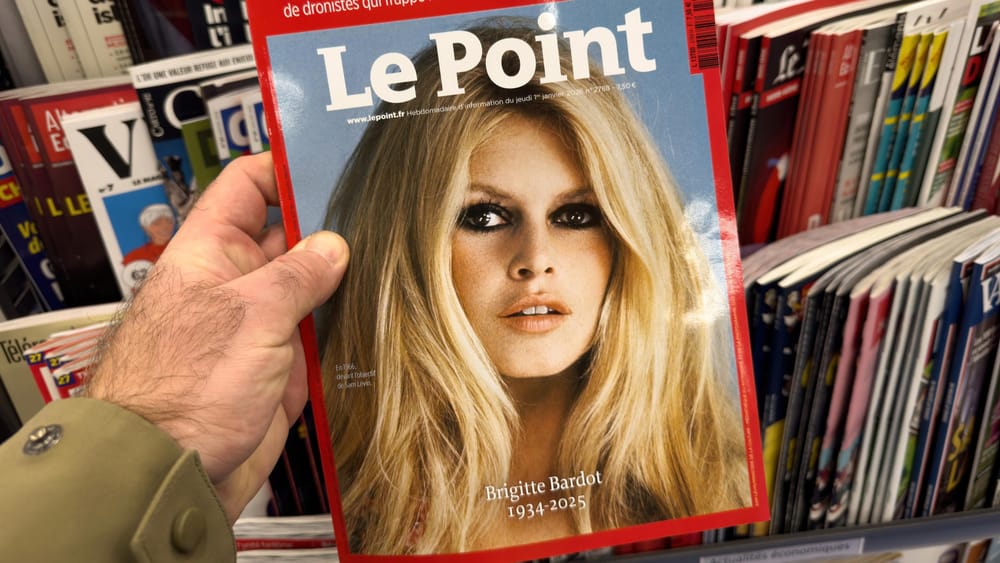Friedrich Merz’ Ruck-Rede: Großspurige Worte, leere Versprechen und die Realität eines entfremdeten Kanzlers
Ein Kommentar von Janine Beicht.
Friedrich Merz, der amtierende CDU-Bundeskanzler, hat am 3. Oktober 2025 in Saarbrücken eine Rede gehalten, die von ihm als Aufruf zu einer neuen Einheit in Deutschland gedacht war. Er forderte eine gemeinsame Kraftanstrengung, um Herausforderungen zu meistern, und betonte, vieles müsse sich ändern, damit das Gute im Land erhalten bleibe. [1]
„Ich denke, heute nach 35 Jahren deutscher Einheit und in einer schwierigen Zeit für unser Land, sollten wir uns neu sammeln und mit Zuversicht und Tatkraft nach vorn blicken. Lassen Sie uns eine gemeinsame Kraftanstrengung unternehmen für eine neue Einheit in unserem Land.“ Friedrich Merz [1]
Merz’ Appell an die Bürger, mit Tatkraft voranzugehen, verliert angesichts seiner eigenen Politik jede Glaubwürdigkeit. Historische Vorbilder wie Winston Churchill, der 1940 seinen Landsleuten nichts als Blut, Schweiß, Mühsal und Tränen versprach, während er selbst Opfer brachte und vor Hitler warnte, zeigen, was eine echte Führungsrede ausmacht [2]. Churchill erschien nach Luftangriffen öffentlich, um Solidarität zu demonstrieren. Merz hingegen zeigt wenig Demut und respektiert die Bürger kaum, die er als nölend, larmoyant und wehleidig beschreibt. [4]
„Lassen Sie uns unser Land nicht schlechtreden. […] Das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. […] Glaubt irgendjemand, dass es mit der AfD besser wird? […] Hören wir doch mal auf, so larmoyant und wehleidig zu sein.“ Friedrich Merz [3]
Sein Umfeld und die Medien kündigten die Rede zum Jahrestag der Deutschen Einheit als „Ruck-Rede“ an, ähnlich wie Roman Herzogs Aufruf 1997 zu einem Mentalitätswechsel.
„Aber es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von lieb gewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ Roman Herzog 1997 [4]
Merz’ Worte wirken eher wie ein Versuch, den Optimismus für alle zu befehlen, ohne die drängenden Probleme konkret anzupacken.
Vage Visionen und ungelöste Rätsel der Einheit
In seiner Ansprache streifte Merz die 35 Jahre deutsche Einheit, doch seine Darstellung bleibt oberflächlich. Er sprach von „Missverständnissen“ zwischen Ost und West, als handle es sich um bloße Kommunikationsprobleme.
„Wir haben in den vergangenen 35 Jahren oft darüber gesprochen, nicht nur, aber vor allem an diesem 3. Oktober, wie alles kam seit dem Sommer und Herbst 1989. Wie viel Mut, wie viel Schmerzliebe sichtbar und wirksam wurden. Und dass diese sogenannte friedliche Revolution in der DDR auch hätte misslingen können. Selbstverständlich war unsere Einheit jedenfalls nicht. Wir haben oft darüber gesprochen, wie groß die wechselseitigen Missverständnisse waren und vielleicht bis heute sind und wie zäh sich manchmal pauschale, hin und wieder sogar abwertende Zuschreibungen noch immer halten." Friedrich Merz [1]
Tatsächlich geht es um tief verankerte strukturelle Ungleichheiten: niedrigere Löhne, geringere Renten, weniger Unternehmenssitze und ein chronischer Mangel an Entscheidungspositionen für Ostdeutsche. [5] Statt Ursachen zu benennen, verweist Merz auf eine angeblich schwindende Freude der Jahre 1989/90, ohne zu erwähnen, dass der rasant vollzogene wirtschaftliche Umbruch Millionen Menschen arbeitslos machte und ganze Industrien zerstörte. Sein Hinweis, der Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen liege noch immer bei nur 20 Prozent, bleibt folgenlos. Er fragt rhetorisch nach Gründen, verschweigt aber, dass CDU-geführte Regierungen über Jahrzehnte selbst kaum etwas daran änderten. Während er die Einheit als international anerkanntes „Gelingen“ preist, ignoriert er offenkundige Defizite: die Abwanderung junger Menschen, die anhaltende Benachteiligung ostdeutscher Regionen bei Infrastruktur und Investitionen sowie die politische Entfremdung.
"Zugleich sind wir immer wieder erstaunt, wie vielen von uns die freudigen Gefühle der Jahre 1989 und 1990 abhanden gekommen sind. Wir haben uns oft gefragt, ob vermeidbare Fehler gemacht wurden oder ob es sich etwa im Bereich der Wirtschaft nicht doch um Unvermeidlichkeit in einem historisch einmaligen Übergang von planwirtschaftlichen zu marktwirtschaftlichen Strukturen gehandelt hat. Wir fragen immer noch, warum in vielen Führungsbereichen eine Zielmarke von 20 Prozent entsprechend dem Bevölkerungsanteil der Ostdeutschen immer noch nicht erreicht ist, auch wenn es Fortschritte gibt." Friedrich Merz [1]
Statt konkrete Antworten zu geben, flüchtet Merz in hohle Schlagworte. Seine Beschwörung eines „freiheitlichen, weltoffenen Deutschland“ wirkt wie ein ausgeleierter Werbeslogan, belanglos, weil niemand ernsthaft das Gegenteil fordern würde. Entscheidend wäre nicht die Wiederholung solcher Textbausteine, sondern eine nachvollziehbare Politik, die den Anspruch tatsächlich trägt. Doch konkrete Maßnahmen nennt er nicht. Sein Ruf nach weniger Regulierung wirkt wie eine Floskel, da weder erklärt wird, welche Regeln überflüssig sein sollen, noch wie dadurch soziale Gerechtigkeit im Osten oder mehr Bürgervertrauen entstehen könnte.
„Wir müssen etwa aus dem Misstrauensmodus heraus und hinein in einen neuen Vertrauensmodus zwischen Staat und Bürger. In Europa und in Deutschland muss es deshalb weniger Regulierung und weniger Kontrolle geben und mehr Vertrauen zwischen Staat und Bürger, zwischen Staat und Unternehmen in unserem Land. Wir müssen wieder mehr Freiheit einräumen […], denn nur aus wirtschaftlicher Stärke heraus können wir schließlich noch einmal den Sozialstaat zu aufstellen, dass wir die sozialen Versprechen, die wir uns ja gegeben haben, auch künftig erfüllen können.“ Friedrich Merz [1]
Gerade dort, wo Misstrauen gegenüber Staat und Politik besonders stark ist, bleibt er Antworten schuldig.
Globale Bedrohungen und innere Angriffe
Merz zeichnet ein Bedrohungsszenario, in dem die liberale Demokratie angeblich von außen angegriffen wird. Doch die eigentliche Erosion kommt aus dem Inneren – und zwar durch das systematische Versagen seiner eigenen Partei. Statt Kurskorrekturen zu wagen, hat sich die CDU längst der gescheiterten Ideologie der Linken unterworfen. Anstatt endlich vernunftsorientiert zu handeln, verteilt Merz Seitenhiebe auf eine Partei, die nie Verantwortung trug, während er selbst einer politischen Tradition entstammt, die seit Jahrzehnten das Fundament der jetzigen Misere gelegt hat.
„Die Ausstrahlungskraft ebenfalls dessen, was wir den Westen nennen, nimmt erkennbar ab. Es versteht sich nicht mehr von selbst, dass die Welt sich an uns orientiert, dass man es unseren Werten der freiheitlichen Demokratie nachtut. Dass wir die Möglichkeit haben, als Teil dieses freien Westens die Welt ein bisschen zum Besseren zu verändern. Neue Allianzen von Autokratien bilden sich gegen uns und greifen die liberale Demokratie als Lebensform an. Unsere freiheitliche Lebensweise wird attackiert, nicht nur von außen, auch von innen.“ Friedrich Merz [1]
Doch die Schwäche, die er beschreibt, ist nicht das Werk fremder Autokratien, sondern das Ergebnis hausgemachter Politik: eine verfehlte Migrationspolitik, die das Land gespalten hat, Milliarden an neuen Schulden ohne klare Zweckbindung, während gleichzeitig Bürger für jeden Cent zur Kasse gebeten werden. 850 Milliarden Euro neue Verpflichtungen, vermutlich noch mehr, ganz ohne Kontrolle, in ideologische Projekte, in die ganze Welt.
Diese Politik erspart der Regierung Mühsal, während sie von Bürgern Opfer einfordert. Wenn Merz’ Umfeld nun mit Schreckensbildern operiert, Russland könne Berlin binnen 15 Minuten erreichen, widerspricht das offenkundig den Realitäten an der ukrainischen Front, wo Moskaus Truppen kaum vorankommen. [6] Solche Angstnarrative sollen eigene Versäumnisse kaschieren: etwa die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Bundeswehr, für die ausgerechnet die CDU die Hauptverantwortung trägt.
„Die Aufgaben, ich will sie noch einmal kurz bündeln, sind folgende: Wir müssen wieder lernen, uns zu verteidigen. Die Machtzentren der Welt verschieben sich in einem Maße, wie wir es seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr gesehen haben. Eine Achse von autokratischen Staaten, die die liberale Ordnung auf der ganzen Welt infrage stellt, fordert die westlichen Demokratien geradezu heraus. Deshalb müssen wir wieder fähig werden, unsere Freiheit zu verteidigen. Diese Verantwortung für unsere Freiheit liegt aber nicht allein bei den politischen Institutionen. Sie liegt bei uns allen. Nehmen wir also diese Verantwortung an. Ein Ausdruck dieser Verantwortung wäre, wieder Wehrdienst zu leisten. Wir machen diesen Dienst attraktiver, um genug Soldatinnen und Soldaten dafür zu gewinnen.“ Friedrich Merz [1]
Dass Merz gleichzeitig den Wehrdienst attraktiver machen und den Soldaten danken will, wirkt wie ein hilfloser Versuch, eigene Schuld zuzudecken.
Koalitionsdilemmata: Sensibilität und Kompromisse, die das Land kosten
Hinter verschlossenen Türen machte Merz klar, dass Klingbeil sensibel sei, so sehr, dass man ihn nicht hart kritisieren solle, [7] selbst wenn seine Vorschläge das Land fehlleiten. Ausgerechnet in dieser Krisenzeit verzichtet der Kanzler also auf eine klare Haltung und nimmt Rücksicht, wo Härte gefordert wäre. Klingbeil räumte in einem Medium ein, tatsächlich sensibel zu sein. [8]
„Ja, ich bin sensibel. Ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn Männer sensibel sind.“ Lars Klingbeil | Tagesspiegel [8]
Diese falsche Rücksichtnahme zeigt, wie die SPD die Koalition dominiert, da Merz brandmauerbedingt keine Alternativen hat und seinen Kanzlerposten sichern will.
Vor der Wahl versprachen CDU und CSU, Milliarden für staatsferne NGOs zu streichen, die in Straßenbau oder Krankenversicherung fehlen, doch viele SPD-Mitglieder arbeiten dort, und Klingbeils Sensibilität verhindert Kürzungen und andere wichtige Reformen.
Merz erklärte auf dem Mittelstandstag in Köln, man solle sich eine positive Einstellung wie in den USA aneignen, wo man sage, es mache Spaß, in diesem Land zu leben und zu arbeiten. [9] Klingbeil klagte ähnlich, man rede sich klein und solle aus dem Kritikmodus heraus. [10] In seiner „Ruck“-Rede griff Merz diese Rhetorik erneut auf. Die Beschwörung von „Larmoyanz“ und „Pessimismus“ mag er sprachlich abgemildert haben, doch der Kern blieb gleich: Er weist den Bürgerinnen und Bürgern die Schuld für Missstände zu, statt Verantwortung für eigenes politisches Versagen zu übernehmen, ein Ton, der nicht aufbaut, sondern herablassend wirkt.
„Erinnern wir uns, wie viel Kraft ein positiver Geist freisetzen kann und wie viel Energie verschwendet und vergeudet wird durch Pessimismus und Lamoyanz. Friedrich Merz [1]
Doch warum es noch Spaß machen solle, in einem Land mit hohen Steuern, verschleuderten Geldern, abwandernden Arbeitsplätzen und Risiken wie Hausdurchsuchungen für Meinungsäußerungen, erklärt Merz nicht. Seine Drohung, weiter Kompromisse mit der SPD zu machen, da kein Wahlprogramm bei unter 50 Prozent vollständig umgesetzt werde [11], unterstreicht die Erpressbarkeit.
Wirtschaftliche Krisen und verpasste Reformen
Merz pries in seiner Rede die Stärken Deutschlands als Land, das Technologie, Qualität, Innovation, Handwerk und eine fast einzigartige soziale Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beherrsche, und forderte einen neuen Ehrgeiz, um technologisch weltweit führend zu bleiben, indem alle sich mehr anstrengen müssten, um den schärferen internationalen Wettbewerb zu bestehen, mit weniger Regulierung, weniger Kontrolle und mehr Vertrauen zwischen Staat, Bürgern und Unternehmen, um aus wirtschaftlicher Stärke den Sozialstaat zu finanzieren und soziale Versprechen zu erfüllen, wobei Reformen unabdingbar seien, um Lasten zwischen Generationen fair zu verteilen und den Kern des Sozialstaats für Bedürftige zu erhalten.
„Wir können Technologie. Wir können Qualität, wir können Innovation, wir können Handwerk, wir können soziale Partnerschaft in den Betrieben, fast einzigartig auf der Welt. […] Und Europa muss den Klimaschutz verbinden mit dem Anspruch, dafür die modernsten Technologien auf der Welt zu entwickeln. Denn nur so lassen sich Menschen begeistern und nur so zweifeln Sie nicht daran, ob Beides miteinander vereinbar ist: Wohlstand und Klimaschutz. Schließlich brauchen wir selbst in unserem Land einen neuen Ehrgeiz, technologisch führend zu sein in der Welt. Und wir müssen uns alle gemeinsam, es wird kein Weg daran vorbeiführen, mehr anstrengen, um diesen international schärfer werdenden Wettbewerb auch zu bestehen. Es gibt für mich keinen Zweifel. Wir haben alle Chancen.“ Friedrich Merz [1]
Doch diese hochtrabenden Worte prallen gegen die harte Realität seiner eigenen Politik, in der er im Bundestag einen Herbst der Reformen ausrief, nur um von Fraktionsvorsitzendem seiner eigenen Partei Jens Spahn, gebremst zu werden, der die Erwartungen drosselte und warnte, spürbare Veränderungen im Sozialstaat kämen frühestens 2026, falls überhaupt, während ein hochrangiger Unionspolitiker einräumte, vor 2027 bewege sich gar nichts.
Merz wetterte gegen das Verbrenner-Verbot aus Brüssel, nannte es falsch und schwor, es zu korrigieren, weil die Technologie global erlaubt sei, und kündigte an, Stöckchen in die Räder zu werfen [12], doch seine SPD-Partner konterten scharf durch Sebastian Roloff, den wirtschaftspolitischen Sprecher, der betonte, solches Zögern gefährde die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die Autoindustrie brauche stattdessen Rückenwind für eine klimaneutrale Zukunft, keinen Rückwärtsgang in die Vergangenheit. [13] Tatsächlich blutet die Branche aus, mit 51.500 verlorenen Jobs in nur einem Jahr, was sieben Prozent der Stellen entspricht, wie sogar die Tagesschau berichtet, was durch sinnlose Energiepolitik, erdrückende Regulierungen und Bürokratie verschärft wird. [14] Merz' markige Ankündigungen verpuffen regelmäßig, sobald der erste Gegenwind aufkommt, und nichts deutet darauf hin, dass er hier durchhält, zumal Wirtschaftsbosse auf einem Gipfel mutigere, schnellere Entscheidungen verlangten, was er anfangs noch teilte, nur um die Kritik persönlich zu nehmen und sie abzubügeln, weil auch er mit Ablehnung nicht umgehen kann. [15]
„In der Politik ist es ja ein bisschen Mode geworden, der Politik weitgehende Machtlosigkeit zu unterstellen in einer zunehmend komplexer werdenden Welt. Ich mache mir diesen Befund ausdrücklich nicht zu eigen.“ Friedrich Merz [1]
Merz' Bekenntnisse auf dem Prüfstand
Merz schwärmte lieber von Europa, als sich mit den handfesten Problemen im eigenen Land zu befassen. Statt auf die sozialen und wirtschaftlichen Bruchstellen in Deutschland einzugehen, zog er es vor, die EU als Heilsbringer zu verklären, jenes Konstrukt, das seit Jahren nichts anderes tut, als nationale Souveränität durch kleinteilige Verbotspolitik und Gängelung zu untergraben. [16] Mit Pathos erinnerte er an seine glorreichen Zeiten als junger Europaabgeordneter von 1989 bis 1994, als er angeblich die „Hoffnungen und Befürchtungen“ der Nachbarn gespürt haben will. Er fabulierte davon, dass Deutschland seit Adenauer „europäisch denke“ und sonnte sich in Macrons Anwesenheit als Symbol der ewigen deutsch-französischen Freundschaft. Europa müsse „Prioritäten setzen“, Wettbewerbsfähigkeit stärken und den Binnenmarkt mit seinen 450 Millionen Einwohnern ausschöpfen, so Merz. In Wahrheit ist sein Appell ein Lehrstück politischer Nebelkerzen: große Worte über ein angeblich starkes Europa, während er in der Praxis nichts als faule Kompromisse liefert und die Bürger zu Statisten eines EU-Theaters degradiert, das längst niemand mehr ernst nimmt.
„Das ist Europa. Das ist der europäische Lebensweg. Das ist der europäische Lebensweg, der über Jahrhunderte gewachsen ist. Und wir sind nur in Europa miteinander stark oder wir sind als einzelne Staaten schwach. Wir in Deutschland wissen: Wenn es Europa gut geht, geht es auch Deutschland gut. Und wenn es Europa nicht gut geht, dann geht es Deutschland überdurchschnittlich schlecht." Friedrich Merz [1]
Merz bemühte sich um Tiefgang, indem er Ernest Renan zitierte: Die Nation sei ein „tägliches Plebiszit“, eine Willensbekundung, die durch gemeinsame Bewältigung wachse. Klingt hochtrabend, bleibt aber so leer wie seine restlichen Floskeln. Er rief dazu auf, Neues zu wagen, Altes hinter sich zu lassen, Spaltungen zu überwinden. Dazu der obligatorische Griff ins Pathos-Archiv: ein Verweis auf die ostdeutsche Zuversicht von 1989. Westdeutsche hätten mit Hilfe der Alliierten Freiheit erlangt, die Ostdeutschen sich selbst befreit.
Wir haben es im Westen mit der Hilfe, nur mit der Hilfe der Amerikaner, der Briten und der Franzosen, aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte heraus in die Freiheit hineingeschafft. Die Menschen in Ostdeutschland haben sich selbst und mit dem eigenen Mut zur Freiheit aus den Fesseln der zweiten deutschen Diktatur gelöst. Lassen wir nicht zu, dass zerstört wird, was wir so errungen haben. Friedrich Merz [1]
Schön erzählt, nur leider passt es nicht zur Gegenwart. Denn die Bürger „bekunden“ heute in überwältigender Mehrheit etwas anderes: 62 Prozent lehnen seine Arbeit ab. [17] Während Merz von Einigkeit schwadroniert, erodiert die innere Sicherheit: Feste werden abgesagt, Messerstechereien und Attentate prägen die Schlagzeilen. Wer das kritisiert, wird als „rechtsradikal“ abgestempelt. Und während er die Nation als demokratisches Projekt verklärt, werden politische Richter installiert [18], die nichts anderes im Sinn haben, als die Opposition kaltzustellen. Merz spricht von Zuversicht, liefert aber die Blaupause für eine Republik der Einschüchterung.
Das Leben wird unbezahlbar, die Bürger verarmen, Unternehmen wandern ab, aber Merz hält eisern an seiner Parallelwelt fest. Er redet von „Veränderungen“ und davon, dass in Deutschland angeblich alles gut sei oder sogar noch besser werden könne. Als ob das nicht schon grotesk genug wäre, legt er nach: Natürlich übernehme die Politik Verantwortung. Die Aufgabe sei groß und alle müssten sie verstehen und annehmen.
„Vieles muss sich ändern, wenn vieles so gut bleiben oder gar besser werden soll, wie es in unserem Land bisher ist. Diesen nicht leichten Moment für unser Land sollten wir nicht als Bedrohung erleben. Lassen Sie uns darin eine Chance sehen, die wir beherzt gemeinsam ergreifen. […] Nun werden manche spätestens an dieser Stelle fragen: Wer ist ‚wir‘ und wer ist ‚uns‘ nun? Meine Damen und Herren, wir. Das ist nicht nur die Politik, das wäre angesichts dieses Umbruchs, den wir erleben, viel zu wenig. Selbstverständlich übernimmt die Politik, übernehmen die Institutionen unseres Staates, übernimmt die Bundesregierung, ihre Verantwortung. Diese Verantwortung ist groß und wir sind uns der Dimension der Aufgabe sehr wohl bewusst. Aber diese Dimension der Aufgabe muss auch von allen verstanden und angenommen werden. Von der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Friedrich Merz [1]
Mit anderen Worten: Die Bürger sollen bitte dankbar die Last schultern, während er den großen Staatsmann mimt und so tut, als wäre Schönreden bereits Politik.
Appelle ohne Konsequenzen und die Suche nach wahrer Führung
Merz' Rede endete mit dem Aufruf, in Einigkeit für Recht und Freiheit zu stehen, und betonte, Demokratie sei öffentliche Auseinandersetzung, vielstimmig und leidenschaftlich.
Lassen Sie uns die Chance ergreifen, eine neue Einheit zu gestalten. Stehen wir in Einigkeit für das Recht und für die Freiheit. Friedrich Merz [1]
Merz dozierte über den Rechtsstaat, unabhängige Gerichte, Gewaltenteilung, Redefreiheit, Presse, Kunst und Wissenschaft, als hätte er ein Schulbuch abgeschrieben. Er malte das Bild einer starken Wirtschaft dank Technologie, Innovation und Handwerk, flankiert von sozialer Partnerschaft und Auffangnetzen für die Schwachen. Merz umschrieb die „unsere Demokratie“ in strahlenden Farben, als lebte man in Deutschland noch in einem Musterstaat nach Lehrbuch.
„Wenn wir hören, was diskutiert und gestritten wird, dann hören wir die Demokratie. Zweitens: Wir wollen ein rechtsstaatliches Land sein. […] Bei uns sind, und auch das muss man heute sagen, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, bei uns sind Richterinnen und Richter keiner politischen Agenda verpflichtet, sondern ausschließlich Recht und Gesetz. Bei uns dient das Recht der Freiheit. Und noch einmal: Bei uns sind vor dem Gesetz alle Menschen gleich. Bei uns begrenzen und kontrollieren sich die Gewalten gegenseitig, damit wir uns als Bürger frei entfalten und selbst bestimmen können. Das ist unser demokratischer Rechtsstaat. […] Die Grundausrichtung unseres Landes ist genau das und muss es auch bleiben. Die Gewaltenteilung etwa, die Kontrolle der Macht, die Freiheit der Wahl, die Freiheit der Rede, der Presse, der Kunst, der Wissenschaft, der Religionsausübung oder der Berufswahl.“ Friedrich Merz [1]
Doch viele Bürger erkennen sich in diesem Bild längst nicht mehr wieder. Für sie haben sich die Verhältnisse in bedenklicher Weise verschoben. Nicht wenige sehen Parallelen zur DDR, während Merz so tut, als herrsche blühende Freiheit. Seine Rede klang daher weniger nach Realitätssinn als nach Schönfärberei, die das Unbehagen weiter verstärkt.
Diese Rede war kein „Ruck“, sondern ein müdes Durchhalte-Mantra, eine Mischung aus Selbstbeweihräucherung, Phrasen-Schleuder und Realitätsverweigerung. Eher eine Beruhigungspille fürs eigene Lager, ein Trockenübungs-Sermon ohne Substanz. Statt Aufbruch: Stillstand im schönsten Politiker-Sprech, garniert mit Pflichtpathos. Man könnte sie auch als „Rückschritt-Rede“ oder schlicht als Sonntagsgerede in Endlosschleife bezeichnen.
Quellen und Anmerkungen
[1] https://www.youtube.com/watch?v=NNsh7ls3I5k (Ab Minute 42:00 bis 1:10:00)
[2] https://www.sueddeutsche.de/politik/churchill-hitler-weltkrieg-1.4924427
[3] https://www.investmentweek.com/hort-auf-zu-jammern-merz-fordert-stimmungswende-wie-einst-scholz/
[4] https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Roman-Herzog/Reden/1997/04/19970426_Rede.html
[12] https://www.zeit.de/news/2025-09/26/merz-will-bruessel-das-stoeckchen-in-die-raeder-halten
[14] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/autobranche-industrie-jobs-100.html
[16] https://www.cicero.de/kultur/kritik-am-eu-parlament-interview-martin-sonneborn
[18] https://apolut.net/kaufhold-auf-dem-richterstuhl-ein-angriff-auf-die-demokratie-von-janine-beicht/
+++
Dank an die Autorin für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Vechta, Deutschland - 19. Februar 2025: Nahaufnahme von Friedrich Merz während eines Wahlkampfes, blickt er zur linken Seite
Bildquelle: Heide Pinkall / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut