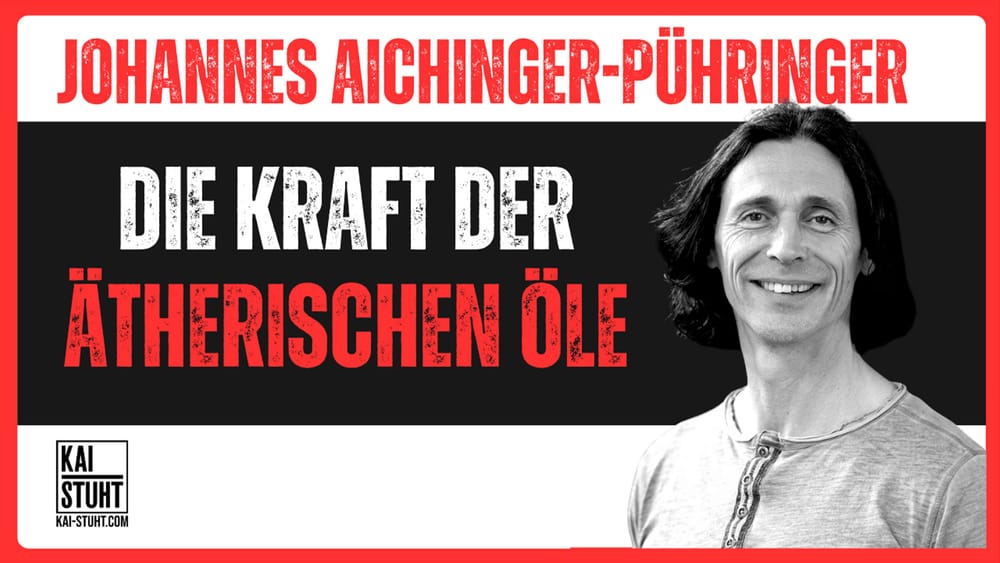“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Comics in Deutschland zu etablieren – das war ein langer, steiniger Weg. Anders in Belgien: Das besitzt seit 1989 ein Comic-Museum. Und in manchem Brüsseler Hotel sind die Zimmerwände mit Cartoons geschmückt. Oder Japan: Da gehören Mangas zur morgendlichen U-Bahnlektüre wie hierzulande die Zeitung. Noch in den Siebzigern galten Comics in der Bundesrepublik als jugendgefährdend, als Sprachvernichter. Eine Feindbild-Funktion, die im folgenden Jahrzehnt die VHS-Cassette übernahm. Derweil steigt die Akzeptanz von Comics. Deutliches Signal: Deren Umbenennung in „Graphic Novels“. Klingt doch gleich seriöser. Dennoch: Das Wissen über diese Kunstform, ihre Genres und Stilrichtungen sind außerhalb der Fan-Szene unbekannt.
Haben Sie beispielsweise vom Comic-Journalismus gehört? Der blüht schon seit drei Jahrzehnten: Zeichner wie Joe Sacco oder Guy Delisle streifen seit den Neunzigern durch Konfliktgebiete wie Sarajevo, Gaza oder die exotische Stadt Pjöngjang. Anschließend zeichnen sie ihre Impressionen. Mancher Cartoonist malt Graphic Novels über die Abgründe der Geschichte: Etwa der New Yorker Art Spiegelman über Auschwitz und der Italiener Igort über Stalins Hungerterror gegen selbständige Bauern. Auch Biographien über Künstler, Dichter oder Philosophen lassen sich via Bildgeschichte vermitteln. Egal, ob Goethe, Nietzsche, Andy Warhol, Nick Cave, Hannah Arendt, Kiki de Montparnasse, Isadora Duncan oder Karl-Heinz Stockhausen. Stilistisch reichen sie vom Realismus früher Buchillustrationen bis hin zum komplexen Form-Experiment.
Vor wenigen Wochen erschien der dritte und letzte Teil einer Comicbiographie, deren Entstehung sich über 30 Jahre hinzog. Ihr Held ist der französische Philosoph Gilles Deleuze. Der zählt zu den wichtigsten Theoretikern der Postmoderne. Gemeinsam mit dem Anti-Psychiater Félix Guattari schuf er Begriffe, die einen festen Platz im akademischen Jargon eroberten. Siebzigjährig und an quälender Atemwegserkrankung leidend, beendete Deleuze sein Leben mit einem Sprung aus dem Fenster. Das war 1995.
Zu den berühmtesten Begriffen des französischen Philosophen zählt das „Rhizom“. Aus der Botanik entliehen, benennt er das Wurzelgeflecht einer Pflanze. Mit ihm attackiert Deleuze die traditionelle Metapher vom Baum des Wissens. Der diente seit Plato als Ordnungsmodell menschlicher Erkenntnisformen. Seine verschiedenen Wissens-Zweige sind hierarchisch angelegt. Immer in Hinblick auf das Zentrum: Dem Baumstamm. Dagegen beschreibt das Rhizom menschliches Wissen als Resultat einer nicht-hierarchischen Vernetzung: Ohne feste Kategorien, ohne Stamm, ohne Zentrum. Ein Symbolbild, dass im Internetzeitalter an Bedeutung noch gewinnt.
Was ist der einzelne Mensch innerhalb des Rhizoms? Deleuze bezeichnet ihn als „Wunschmaschine“. Das Individuum ist kein in sich geschlossenes Subjekt, sondern ein offenes System, das mit anderen interagiert. Durch dieses Zusammenspiel der Wunschmaschinen entstehen endlos viele, ineinandergreifende Energieflüsse, die sich kreuzen, sich gegenseitig verändern, abbiegen, unterbrechen und weiterfließen. Ein chaotisches Werden ohne Ziel und Ende.
Zurück zum Comic: Der letzte Teil der biographischen-Trilogie, erschienen im Reprodukt-Verlag, trägt den Titel: „Salut, Deleuze!“ und enthält auch beide Vorgängerbände. Kurzum, das volle Programm. Allerdings erzählen Autor Jens Balzer und Zeichner Martin tom Dieck keine Lebensgeschichte. Nein, ihr Bildband setzt ein, wo Biographien gewöhnlich aufhören: Mit dem Tod des Helden. Genauer: Mit seiner Reise durchs Jenseits. Dieses Totenreich ist freilich kein christliches. Es erinnert an Platos Jenseits-Vision aus der „Apologie des Sokrates“: Darin spekuliert der griechische Denker über künftige Treffen im Hades, wo er mit den Weisen früher Zeiten debattieren wolle.
Wie gesagt: Der Comic startet unmittelbar nach dem Tod von Deleuze. Der Philosoph mit dem Beuys-Hut steht am Ufer des Totenflusses Lethe. Im Bootshaus erwartet ihn der Fährmann. Deleuze zahlt, steigt in ein Ruderboot und wird zum anderen Ufer gebracht. Dort warten bereits verstorbene Kollegen auf ihn: Roland Barthes, Jacques Lacan und Michel Foucault. - Und dann? - Dann beginnt die Geschichte wieder von vorne: Der Philosoph mit dem Beuys-Hut steht am Ufer des Totenflusses Lethe. Im Bootshaus erwartet ihn der Fährmann. Deleuze zahlt, steigt in ein Ruderboot und wird zum anderen Ufer gebracht, und so weiter. Das Ganze wiederholt sich vier Mal. Dabei wird dem Leser mulmig. Ist so das Totenreich? Ist das die Ewigkeit? Ein ständiges Wiederholen von Immergleichem?
Bald jedoch merkt man: Nein, völlig identisch sind die Wiederholungen nicht. Es gibt kleine Abweichungen in Text und Bild. Deleuze-Kenner ahnen bereits, was hier umgesetzt wurde: Eine zentrale Theorie des Franzosen, inspiriert durch Nietzsches Ewige Wiederkehr des Gleichen. Nach Deleuze gibt es keine Wiederholung ohne Unterschiede, ohne Differenz. Tatsächlich besteht Leben, besteht jeglicher Prozess aus Wiederholen. Aber kleine, marginale, minimale Unterschiede sorgen dafür, dass Neues entsteht. Die Abweichung ist es, die den Prozess des Werdens antreibt.
Martin tom Diecks Zeichenstil unterstreicht die Unheimlichkeit der Szenerie. Wie in einem expressionistischern Holzschnitt: Schwarzweiß ohne Zwischentöne. Erst später, wenn Neuankömmling Deleuze sich eingewöhnt hat, entschärfen Grautöne den brutalen Kontrast.
Eine weitere Szene: Im Jenseits trifft unser Philosophen-Quartett auf den Begründer der Psychoanalyse: Sigmund Freud. Gegen dessen Theorie vom Ödipus-Komplex hatten Deleuze und Guattari im „Anti-Ödipus“ rebelliert. Bei Freud, so kritisierte der französische Philosoph, basiere jede Aktivität auf Kompensation von Mangel, während der Mensch doch unendliche Wünsche besäße, die ihn in die Welt, in den Kontakt, in die Vernetzung treiben. Im Comic sammelt Freud Pilze im Wald. Es kommt zum Wortgefecht zwischen Deleuze und dem Traumdeuter aus Wien. Während Freud im Pilz ein klares Phallus-Symbol erkennt, fixiert der Franzose auf das Wurzelwerk, das Rhizom. Hier die patriachale, zentrierte Ordnung des Phallus, dort das unhierarchische postmoderne Wurzelwirrwarr.
An dieser Stelle lohnt eine Assoziation zur gegenwärtigen Botanik. Man entdeckte unlängst, dass Pflanzen durch ihre Wurzeln nicht bloß Wasser und Nährstoffe aufnehmen, sondern auch Informationen weitergegeben. Für die Weitergabe ist ein Netzwerk aus Pilzfäden zuständig. Deleuzes Vorliebe für die Pilzmetapher findet auch hier Bestätigung. Dieses Informationssystem wird inzwischen als „Wood Wide Web“ bezeichnet. Zu den Infos, die sich Pflanzen gegenseitig zuspielen, zählen Warnsignale vor Schädlingen oder über Nährstoffmangel. Laut dieser Pflanzen-Neurobiologie besitzen alle Wälder ein unterirdisches Internet. Und wie beim menschlichen Internet besitzt es keine Zentrierung und keine Hierarchie.
Noch zwei kleine Spoiler: In „Salut, Deleuze!“ begegnen die Philosophen dem Liebespaar Orpheus und Eurydike und basteln an einer Zeitmaschine, die in der Ewigkeit kaum Freude bereitet. Mehr sei nicht verraten. Zum Abschluss noch eine Vorwarnung: „Salut, Deleuze“ ist kein Comic zum Einstieg in dessen Philosophie, kein „Deleuze für Anfänger“. Es setzt kein detailliertes Nerd-Wissen voraus, wohl aber eine vage Kenntnis der Hauptthesen.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: der französische Philosoph Gilles Deleuze
Bildquelle: By Tintinades - Vlastito djelo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148372947/ wiki commons
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut