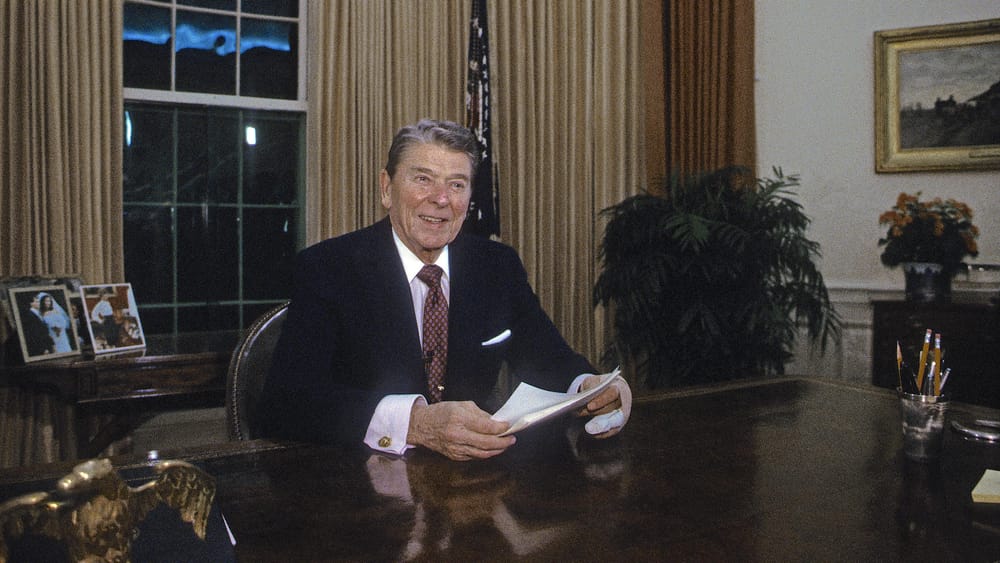Ein Meinungsbeitrag von Günther Burbach.
Es gab eine Zeit, in der Worte wie Ausnahmezustand, Notfall oder Krise ein Warnsignal waren, temporär, außergewöhnlich, mit der klaren Erwartung, dass danach wieder Normalität einkehrt. Heute ist das Gegenteil der Fall: Der Ausnahmezustand ist zum Alltag geworden, die Krise zum Regelfall, und das Sicherheitsdenken hat sich zu einer eigenen Regierungsform entwickelt. Man könnte fast sagen: Der Staat hat sich an die Krise gewöhnt, oder schlimmer, er braucht sie.
Wer die Schlagzeilen der letzten Jahre verfolgt, erkennt das Muster: Pandemie, Energiekrise, Ukrainekrieg, Cyberbedrohung, hybride Kriegsführung, Desinformation, Terrorgefahr, Klimanotstand, Drohnenalarm. Es gibt keine Atempause mehr, kein „Dazwischen“. Politik, Verwaltung und Medien rotieren von Alarm zu Alarm und jedes Mal werden die Eingriffe in Rechte, Kommunikation und öffentliche Strukturen ein Stück weiter normalisiert. Wo früher demokratische Aushandlung stand, herrscht heute operative Lagebesprechung.
Dieses Denken in permanenter Gefährdung ist kein Zufall. Es folgt einer systemischen Logik: Wer Krise sagt, darf handeln, ohne lange zu fragen. „Sicherheit“ ist die einzige Währung, die noch Vertrauen erzeugt. Und so verschiebt sich die Machtachse leise, weg von Öffentlichkeit, hin zu Exekutive, Expertenräten und sicherheitspolitischen Gremien. Demokratie verengt sich auf eine Zuschauerrolle, während Behörden, Militär und Krisenstäbe das Steuer übernehmen. Was einst als Notfallmechanismus gedacht war, wird zum Dauerinstrument: von der Pandemieverordnung über Energie-Notfallpläne bis hin zu den neuen Strukturen der „Zivil-Militärischen Zusammenarbeit 4.0“, die im sogenannten Grünbuch ZMZ entworfen werden.
Das Besorgniserregende daran ist nicht nur der Inhalt dieser Dokumente, sondern der Geist, der ihnen innewohnt. Es ist der Geist einer Regierung, die ihrem eigenen Volk misstraut. Statt Vertrauen zu stärken, produziert man Resilienzprogramme, Informationskampagnen, Abwehrmaßnahmen, als sei der Bürger selbst Teil einer potenziellen Bedrohung. Das Klima der Angst ersetzt das Gespräch. Was früher politischer Streit war, wird heute als Sicherheitsrisiko eingeordnet. Und wer den Alarmton hinterfragt, gerät selbst unter Verdacht, nicht „resilient“ genug zu sein.
Damit hat sich ein neues Paradigma etabliert: Sicherheit nicht mehr als Schutz der Freiheit, sondern als Bedingung ihrer Einschränkung. Der Staat präsentiert sich als Garant der Ordnung in einer chaotischen Welt, während er selbst die Ausnahme zum Prinzip erhebt. Die Folge ist ein schleichender Umbau, rechtlich, institutionell, mental. Es geht nicht darum, Panzer auf die Straßen zu bringen, sondern um Strukturen, die jederzeit greifen können, wenn man den nächsten „Spannungsfall“ ausruft. Und genau das ist der Punkt, an dem das Grünbuch ZMZ 4.0 und die jüngsten Forderungen nach dem Spannungsfall ineinandergreifen: als Vorbereitungsdokument einer Zukunft, in der Krisen zur Legitimationsbasis von Macht geworden sind.
Das Grünbuch ZMZ 4.0: Wenn zivile Strukturen militärisch denken lernen
Im Januar 2025 erschien das unscheinbar betitelte „Grünbuch ZMZ 4.0“, herausgegeben vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (ZOES e. V.), unterstützt von Bundeswehr, Innenministerium, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie mehreren Landesbehörden. Auf den ersten Blick liest es sich wie eine sachliche Fachanalyse über Krisenvorsorge und Katastrophenschutz. Doch wer genauer hinschaut, erkennt ein anderes Programm: Es ist ein Drehbuch für die schrittweise militärische Durchdringung ziviler Verwaltung.
Das Papier beschreibt, wie zivile und militärische Akteure künftig „verzahnt“ agieren sollen, in Krisen, Notfällen, hybriden Konflikten, ja selbst in Phasen gesellschaftlicher „Destabilisierung“. Offiziell dient das der „Resilienzsteigerung“. In Wahrheit aber verschiebt es Grenzen, die bislang als demokratische Sicherungen galten: zwischen Polizei und Armee, zwischen Verwaltung und Verteidigung, zwischen Bürger und Staat.
Im Kern geht es darum, den Ausnahmezustand planbar zu machen. Das Grünbuch fordert eine „integrierte Sicherheitsarchitektur“, die alle Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Bevölkerung, in eine gemeinsame sicherheitspolitische Matrix einbindet. Behörden sollen künftig „lagebildfähig“ arbeiten, Daten austauschen, sich an „zentralen Lagezentren“ beteiligen. Mit anderen Worten: die Logik des Militärs, nur ohne Uniform.
Noch beunruhigender ist der Begriff der „zivil-militärischen Resilienz“. Er klingt harmlos, ist aber das Gegenteil. In diesem Konzept ist der Bürger kein mündiger Akteur mehr, sondern ein Teil der Verteidigungslinie. Alles, Infrastruktur, Medien, Lieferketten, Kommunikation, sogar öffentliche Meinung, wird als sicherheitsrelevantes Element betrachtet. Wer abweicht, stört die Abwehrfähigkeit. Protest, Kritik oder zivilgesellschaftlicher Widerstand erscheinen so nicht mehr als Ausdruck demokratischer Vielfalt, sondern als „Vulnerabilität“, als Schwachstelle, die man „adressieren“ muss.
Das Grünbuch ZMZ 4.0 reiht sich nahtlos in eine Serie ähnlicher Dokumente ein, die seit Jahren das gleiche Ziel verfolgen: die totale Mobilmachung im Namen der Sicherheit. Nach dem Weißbuch der Bundeswehr (2016), dem „Konzept Zivile Verteidigung“ (2017) und den jüngsten „Nationalen Sicherheitsstrategien“ (2023 / 2024) ist es der nächste Schritt einer administrativen Selbstaufblähung, die kaum noch demokratische Kontrolle kennt. Der Clou: Diese Texte werden nicht als Gesetze verabschiedet, sondern als „Diskussionsgrundlagen“. Damit können sie ohne parlamentarische Debatte in Behördenhandeln übersetzt werden.
Das BBK und das Verteidigungsministerium verweisen darauf, dass es sich lediglich um Empfehlungen handle. Doch in der Praxis gilt: Was einmal in Verwaltungsvorgaben steht, wird umgesetzt. In internen Schulungen und Planspielen wird bereits geprobt, wie Versorgungsketten, Medienkommunikation und Bevölkerungsschutz unter militärischer Führung funktionieren. Das Grünbuch nennt explizit Szenarien von „hybrider Einflussnahme“, „Cyberangriffen“, „kritischen Infrastrukturausfällen“ und jedes dieser Stichworte kann politisch beliebig ausgelegt werden.
Damit etabliert sich ein neues Denken: Zivile Verwaltung als Teil der nationalen Verteidigung. Und das hat Folgen. Wenn Behörden nicht mehr in erster Linie öffentliche Daseinsvorsorge leisten, sondern Teil eines Sicherheitsapparats werden, verändert sich ihr Verhältnis zum Bürger. Kontrolle wird zur Gewohnheit, Misstrauen zur Grundhaltung, Kommunikation zur Informationslenkung.
Die innere Logik lautet: Vorbereitet sein heißt, auch das Unwahrscheinliche durchzuspielen. Aber im Namen dieser Vorbereitung wird das Undenkbare salonfähig. Wer permanent Krieg simuliert, fängt irgendwann an, ihn für unvermeidlich zu halten. Und wer Verwaltung an militärische Entscheidungslogik gewöhnt, schafft die psychologische Brücke, über die jede Notstandsmaßnahme später als „rational“ erscheinen kann.
Das Grünbuch ZMZ 4.0 ist damit nicht nur ein Verwaltungsdokument, es ist ein Symptom. Es markiert die ideologische Verschiebung von der sozialen zur sicherheitspolitischen Republik. Ein Staat, der alles als potenzielle Bedrohung betrachtet, wird irgendwann selbst zur Bedrohung.
Kiesewetters Spannungsfall: Die juristische Brücke zum Ausnahmezustand
Wenn politische Systeme beginnen, ihre Sprache zu militarisieren, sollte man hellhörig werden. Begriffe wie „Spannungsfall“, „Verteidigungsfähigkeit“ oder „Resilienz“ klingen technisch, fast steril, doch in ihnen steckt Macht. Und Macht verändert sich zuerst in der Sprache, bevor sie sich in Strukturen niederschlägt. Genau das erleben wir derzeit.
Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat im Herbst 2025 den Vorschlag gemacht, Deutschland solle angesichts der jüngsten Drohnenvorfälle den sogenannten „Spannungsfall“ ausrufen. Was auf den ersten Blick wie eine administrative Formalität klingt, ist tatsächlich ein verfassungsrechtlicher Ausnahmezustand. Der Spannungsfall ist im Grundgesetz (Artikel 80a) verankert, er darf vom Bundestag mit Zweidrittelmehrheit festgestellt werden, wenn die „äußere Sicherheit“ der Bundesrepublik bedroht scheint, aber noch kein Kriegszustand besteht.
Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Denn mit der Ausrufung des Spannungsfalls werden ganze Bündel an Sondervollmachten aktiviert:
- Der Bund erhält weitreichende Zugriffsmöglichkeiten auf Länderkompetenzen.
- Die Bundeswehr darf unter bestimmten Umständen im Innern eingesetzt werden.
- Vorratsgesetze aus der Zeit des Kalten Krieges (Sicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz) treten in Kraft.
- Kommunikations-, Energie- und Verkehrsinfrastrukturen können zentralisiert und militärisch koordiniert werden.
- Auch die Wehrpflicht könnte in diesem Rahmen wieder aktiviert werden.
Mit anderen Worten: Der Spannungsfall ist die juristische Brücke vom demokratischen Alltag zur Notstandsordnung. Und er ist nicht dafür gedacht, leichtfertig betreten zu werden. Dass nun ein Bundestagsabgeordneter diesen Schritt öffentlich fordert, aufgrund unklarer Drohnenereignisse, die bisher keine konkreten Gefahrennachweise lieferten, markiert eine gefährliche Schwelle.
Kiesewetters Argumentation ist dabei exemplarisch für das neue sicherheitspolitische Denken: Er beruft sich auf „Vorbereitung“, „Abschreckung“, „Resilienz“. Der Staat müsse „handlungsfähig“ sein. Das klingt vernünftig, bis man genauer hinsieht, was darunter verstanden wird. Denn Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten bedeutet fast immer Machtkonzentration. Sie verschiebt die Balance zwischen Legislative und Exekutive, zwischen ziviler Kontrolle und militärischer Verwaltung.
Es ist genau dieses Narrativ, das das Grünbuch ZMZ 4.0 vorbereitet: ein Staat, der jederzeit in Bereitschaft ist, in dem militärische Planungslogik und zivile Verwaltung nahtlos ineinandergreifen. Der Spannungsfall liefert dafür die rechtliche Fassung, das ist kein Zufall, sondern Komplementärpolitik. Das eine entwirft die Struktur, das andere schaltet sie scharf.
Dass solche Forderungen kaum Widerspruch in den großen Medien finden, zeigt, wie sehr sich das Denken verschoben hat. Früher wäre der Ruf nach einem Spannungsfall ein politisches Erdbeben gewesen, heute ist es ein Zitat im Nachrichtenticker. Man hat sich an die Sprache der Bedrohung gewöhnt. Sie lullt ein, statt zu alarmieren.
Das Gefährlichste daran: Der Spannungsfall ist kein Ereignis, er ist ein Zustand, der sich selbst reproduzieren kann. Ist er einmal erklärt, kann man ihn kaum wieder zurücknehmen, ohne das Narrativ der Gefahr zu untergraben. Kein Politiker will später verantwortlich sein, wenn etwas passiert, das man „hätte verhindern können“. Also bleibt der Ausnahmezustand bestehen, erst provisorisch, dann dauerhaft. Das hat die Geschichte der Notstandsgesetze in der Bundesrepublik bereits einmal gezeigt: Was als vorübergehende Maßnahme eingeführt wurde, wurde später fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur.
Kiesewetters Vorstoß markiert deshalb weniger eine Panikreaktion als vielmehr einen Testballon. Man tastet die gesellschaftliche Akzeptanz ab: Wie weit lässt sich Sicherheitsrhetorik treiben, ohne Widerspruch zu ernten? Wie stark ist der Reflex „Ja, wenn’s der Sicherheit dient“? Und wie leicht kann man verfassungsrechtliche Notinstrumente in politische Routine verwandeln?
Es sind diese feinen Übergänge, die gefährlich sind, nicht der große Putsch, sondern das leise Einrasten der nächsten Stufe. Das System testet seine Toleranzgrenzen, und die Öffentlichkeit merkt es kaum. Der Spannungsfall wird so zum psychologischen Manöver: kein militärischer Alarm, sondern ein mentaler Ausnahmezustand.
Die Frage, die sich stellt, lautet also nicht: Kommt die Militarisierung?
Sondern: Sind wir nicht längst dabei, sie zu verinnerlichen?
Vom Sicherheitsdenken zur Sicherheitsdoktrin: Wie Politik Angst zur Steuerung nutzt
Es gibt ein einfaches Rezept, um Macht zu festigen, ohne Gewalt anzuwenden: Man muss den Menschen nur lange genug Angst machen. Nicht mit einer großen Lüge, sondern mit vielen kleinen Wahrheiten, geschickt miteinander verknüpft. Jede Krise für sich ist real, eine Pandemie, ein Krieg, ein Stromausfall, eine Sabotage, ein Hackerangriff. Doch wenn alles gleichzeitig zur Bedrohung erklärt wird, entsteht ein permanenter Ausnahmezustand im Kopf. Genau das ist der Nährboden, auf dem die neue Sicherheitsdoktrin gedeiht.
Seit Jahren beobachten Soziologen, wie sich die politische Kultur in westlichen Demokratien verändert. Früher galt Sicherheit als Schutzraum der Freiheit, heute wird Freiheit selbst zur Bedrohung, die man kontrollieren muss. Je mehr individuelle Unabhängigkeit, desto mehr Risiko, so das implizite Mantra. Der Bürger wird damit vom Souverän zum Sicherheitsfaktor degradiert. Vertrauen, einst Grundlage demokratischer Gesellschaften, wird durch Überwachung ersetzt, flankiert von dem Versprechen, dass all dies nur zu seinem Besten geschehe.
In Deutschland hat sich dieses Denken tief in den politischen Alltag gefressen. Man spricht nicht mehr von Vorsicht, sondern von „Resilienz“, „Vulnerabilität“, „Handlungsfähigkeit“. Wörter, die früher nach Verwaltungsseminar klangen, sind heute ideologische Marker. In der Sprache der Sicherheit steckt bereits die Hierarchie: Es gibt einen, der schützt, und viele, die geschützt werden müssen. Der Beschützer kontrolliert, definiert, bewertet und niemand fragt, wer ihn kontrolliert.
Das ist die eigentliche Macht des Dauerkrisenmodus: Er erzeugt psychologische Unterwerfung. In einer Welt, die angeblich ständig am Abgrund steht, wird Gehorsam zur Tugend, Widerspruch zum Risiko. Die Bevölkerung gewöhnt sich an Eingriffe, erst in Bewegungsfreiheit, dann in Kommunikation, schließlich in Gedankenräume. Man akzeptiert Eingriffe, weil sie im Ausnahmezustand als notwendig erscheinen. Und wenn der Ausnahmezustand nie endet, wird die Ausnahme zur Normalität.
Diese Mechanik kennt man aus der Geschichte: Angst ist das Schmiermittel der Macht. Doch im digitalen Zeitalter hat sie eine neue Dimension erreicht. Informationskontrolle erfolgt heute algorithmisch, automatisiert, subtil. Während früher Zensur ein sichtbarer Akt war, geschieht sie heute als „Inhaltsmoderation“, „Desinformationsbekämpfung“, „Schutz vor Hassrede“. Die Schlagworte wechseln, das Prinzip bleibt gleich: Schutz ersetzt Verantwortung. Der Bürger soll nicht mehr entscheiden, sondern „vertrauen“.
In dieser Logik wird jede Form von Kritik potenziell gefährlich. Wer Sicherheitsmaßnahmen infrage stellt, gilt schnell als unsolidarisch, als Verharmloser oder schlimmer, als Verbündeter der „anderen Seite“. Diese moralische Abriegelung der Debatte ist vielleicht das perfideste Werkzeug des neuen Sicherheitsstaats. Sie funktioniert nicht mit Zwang, sondern mit sozialem Druck. Man braucht keine Polizei, wenn man Empörung hat.
Der Staat lernt aus diesen Mechanismen und zwar schnell. Nach Corona, im Ukrainekrieg, in der Energiekrise hat sich ein kollektives Verhalten etabliert: Sofortmaßnahme statt Deliberation, Ausnahmegenehmigung statt Grundsatzdebatte. Das alles lässt sich administrativ sehr gut mit dem Vokabular der „Krisenbewältigung“ rechtfertigen. Und wer dagegenhält, läuft Gefahr, als „Verzögerer“ oder „Verharmloser“ etikettiert zu werden.
Die Bundesregierung hat 2024 und 2025 gleich mehrere Sicherheitsstrategien veröffentlicht, nationale, digitale, militärische, und sie alle folgen dem gleichen Drehbuch: Vorsorge ist Verantwortung. Dahinter verbirgt sich ein simples Prinzip: Der Staat definiert, was gefährlich ist und wer gefährlich ist. Diese Definitionsmacht ist der Kern jeder Sicherheitsdoktrin. Denn sobald man eine Gesellschaft in Freund und Feind aufteilt, braucht man keine Überzeugung mehr, nur noch Kontrolle.
Genau hier schließt sich der Kreis zum Grünbuch ZMZ 4.0 und zur Diskussion um den Spannungsfall. Beide sind Ausdruck eines politischen Denkens, das den Bürger nicht mehr als Souverän, sondern als Risiko begreift. Und beide bauen auf der Idee auf, dass nur ein starker, durchorganisierter, jederzeit bereiter Staat überleben könne. Doch dieser Staat, der alles absichern will, verliert am Ende das, was er zu schützen vorgibt: seine demokratische Seele.
Die Sicherheitsdoktrin, die sich hier formt, ist keine Verschwörung, sie ist ein Prozess. Ein Prozess, in dem Angst zur Währung und Gehorsam zur Gewohnheit wird. Ein Prozess, der nicht mit einem Putsch beginnt, sondern mit einem Formular, einem Erlass, einem Grünbuch. Und während die Menschen noch glauben, sie lebten in Normalität, dreht sich die Schraube unbemerkt weiter an.
Die leise Militarisierung des Alltags: ZMZ, Infrastruktur, Medien, Bürgerpflicht
Militarisierung im 21. Jahrhundert trägt keine Stiefel und marschiert nicht. Sie rollt auf Rädern aus Paragrafen, Datenbanken und Verwaltungsvorschriften. Sie spricht die Sprache der Vorsorge und der Systemrelevanz. Wer ihre Signale hören will, muss genau hinhören, denn sie kommt nicht mit Trommelwirbel, sondern mit Beamtendeutsch.
Seit Veröffentlichung des Grünbuchs ZMZ 4.0 sickert dieses Denken Schritt für Schritt in die alltägliche Verwaltung. Landratsämter sprechen von „Krisenlagen“, Stadtwerke von „kritischen Infrastrukturen“, Schulämter üben Evakuierungsszenarien, Landesmedienanstalten warnen vor „Desinformation“. Jedes dieser Felder ist für sich genommen plausibel, zusammen aber ergibt es ein Bild permanenter Mobilmachung. Das Land befindet sich in einem Zustand der vorbeugenden Alarmbereitschaft.
Der entscheidende Punkt: Der zivile Bereich übernimmt militärische Denklogik. Wo früher Dienstanweisungen reichten, heißt es heute „Lagebild“, „Führungsstruktur“ oder „Einsatzstab“. Kommunale Verwaltung wird zum „Resilienznetz“, Medienhäuser zu „Verstärkern der gesamtgesellschaftlichen Verteidigungsfähigkeit“. Der Bürger selbst taucht als „Akteur im Rahmen nationaler Sicherheit“ auf. Damit wird er Teil eines Systems, das ihn gleichzeitig schützt und kontrolliert.
Ein Beispiel: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) arbeitet nach eigenen Angaben an einem „integrierten Lagezentrum“, das zivile und militärische Informationen zusammenführt, angeblich um „Reaktionszeiten in Krisen zu verkürzen“. In der Praxis entsteht eine Schnittstelle, die alle großen Sicherheitsbehörden vernetzt: Polizei, Bundeswehr, Cyberabwehr, Gesundheitswesen, Energieversorger. Ein System, das permanent „Lagebilder“ erzeugt, schafft auch den Druck, dass es ständig etwas zu beobachten gibt. Und wenn es nichts zu sehen gibt, sucht es nach Risiken um seine Existenz zu rechtfertigen.
Parallel läuft eine Art softer Pflichterziehung an. Statt Zwang arbeitet man mit Appellen: „Bevorraten Sie Wasser und Lebensmittel für zehn Tage“, „Halten Sie Ihr Smartphone einsatzbereit für Warnmeldungen“, „Melden Sie verdächtige Drohnenaktivitäten“. Der Bürger wird Teil der Sicherheitsarchitektur, ob er will oder nicht. Das alles ist noch kein Zwangsstaat, aber es prägt Verhalten. Wer ständig auf Krisen trainiert wird, lebt irgendwann nur noch im Krisenmodus.
Auch die Medienlandschaft spielt inzwischen eine Rolle, die einst dem Bundespresseamt vorbehalten war. Große Anstalten betreiben gemeinsame „Faktenzentren“ mit Ministerien und stellen ihre Krisenkommunikation auf „strategische Kohärenz“ um, ein Begriff aus dem Militärjargon. Offen wird von „kommunikativer Resilienz“ gesprochen: Der Bevölkerung soll eine einheitliche, vertrauensstiftende Sprache vermittelt werden. Das klingt nach Pädagogik, ist aber Propaganda im Gewand der Prävention. Denn wer die Worte kontrolliert, kontrolliert das Denken.
Unter dem Radar läuft zugleich eine Modernisierung der digitalen Infrastruktur, die militärisch genutzt werden kann. Im Rahmen der „Digitalen Souveränität“ entstehen Cloud-Netze mit Datenzugriff für Sicherheitsbehörden. Die Schnittstellen zwischen zivilen Betreibern und staatlichen Stellen werden dabei immer enger. Das heißt nicht, dass jemand heimlich eine Diktatur aufbaut, aber es heißt, dass die Infrastruktur für eine sehr starke Zentralmacht schon existiert. Man muss sie nur nutzen wollen.
Selbst die Wehrpflicht kehrt durch die Hintertür zurück, nicht als Zwang, sondern als „Gesellschaftsdienst“. Das Verteidigungsministerium prüft Modelle für einen „Freiwilligen Grunddienst zur Stärkung der Resilienz“. Was sozialpädagogisch klingt, ist de facto eine Vorstufe der Totalmobilmachung: Der Staat fordert nicht mehr nur Steuern und Gesetze, er fordert Lebenszeit und Gefolgschaft. Wer nicht mitmacht, gilt nicht mehr als Teil der Solidargemeinschaft, sondern als Lücke im System.
So entsteht eine neue Kultur des Gehorsams, ohne Uniform, aber mit Algorithmus. Die Militarisierung des Alltags vollzieht sich nicht in Panzern auf den Straßen, sondern in Denkgewohnheiten, in Verwaltungssprache, in digitalen Prozessen. Sie ist unsichtbar und genau deshalb so gefährlich. Denn wer militärisch denkt, sucht nicht mehr nach Kompromissen, sondern nach Feinden. Und ein Staat, der überall Feinde vermutet, wird seine Bürger früher oder später wie Feinde behandeln.
Was das bedeutet: Der permanente Alarm als System und seine Gefahr für die Demokratie
Der vielleicht gefährlichste Wandel der vergangenen Jahre ist nicht politisch, sondern psychologisch. Deutschland befindet sich in einem Zustand der Daueranspannung, der längst zum neuen Normal erklärt wurde. Kaum ein Monat vergeht ohne irgendeine Warnung, ohne neue Bedrohungsszenarien, ohne die nächste Sondersitzung im Bundestag oder Sicherheitsgipfel in Brüssel. Der Bürger wird darauf konditioniert, den Ausnahmezustand als Teil des Alltags zu akzeptieren. Das ist kein Unfall, es ist eine Methode.
Denn ein Volk, das im Alarmzustand lebt, ist leichter zu lenken. Angst ist kein Nebeneffekt, sondern ein Instrument. Wer ständig Gefahr wittert, fragt nicht mehr nach Ursachen, sondern nach Schutz. Er will nicht mehr diskutieren, sondern Ruhe. Der Staat, der diesen Schutz verspricht, erhält dafür ein stilles Mandat zur Ausweitung seiner Befugnisse. Das ist der unsichtbare Handel, der im Schatten jeder „Krisenkommunikation“ stattfindet: Ein Stück Freiheit gegen ein bisschen Sicherheit, immer wieder, bis am Ende kaum etwas übrig bleibt.
Die Strukturen, die dafür nötig sind, existieren längst. Das Grünbuch ZMZ 4.0 entwirft die organisatorische Architektur; der Spannungsfall liefert die juristische Legitimation; und die Sicherheitsdoktrin liefert den mentalen Rahmen. Drei Zahnräder, die perfekt ineinandergreifen. Und jedes Mal, wenn ein Zahnrad dreht, wird das System ein Stück geschmeidiger, ein Stück effizienter, aber auch ein Stück gefährlicher. Denn Effizienz ist kein Wert an sich, wenn sie auf Kosten der Kontrolle geht.
Die Ironie dieser Entwicklung ist bitter: Aus Angst vor Chaos schafft man Strukturen, die Chaos verhindern sollen und genau diese Strukturen können, einmal in falschen Händen, die Freiheit zerstören. Man muss sich nur vorstellen, ein künftiger Krisenstab hätte Zugriff auf alle Kommunikationsdaten, auf die Mobilität der Bürger, auf Energieversorgung und Transportnetz, und gleichzeitig das Mandat, „Desinformation“ zu unterbinden. Das ist keine Fantasie, es ist, Stand heute, rechtlich vorbereitet und technisch möglich.
Noch halten viele Menschen das für übertrieben. Aber genau darin liegt die Gefahr: Die schleichende Normalisierung. Jede Maßnahme für sich scheint nachvollziehbar, jede Reform rational begründet. Niemand beschließt offen eine „Militarisierung des Inneren“. Sie passiert, weil niemand sie stoppen will, und weil es für Politiker, Behörden und Sicherheitsapparate bequem ist, wenn das Land in ständiger Alarmbereitschaft bleibt. In der Krise regiert es sich leichter: Man braucht keine Mehrheit, sondern nur Dringlichkeit.
Diese Entwicklung entzieht der Demokratie ihre Substanz. Denn Demokratie lebt vom Streit, von Zeit, vom Zweifel und genau diese drei Dinge verschwinden im Krisenmodus. Wenn alles unter „Handlungsdruck“ steht, bleibt keine Zeit für Abwägung. Entscheidungen werden exekutiv, nicht deliberativ. Der Bürger wird Zuschauer einer Politik, die sich selbst in Notstandslogik verstrickt. Und je länger das anhält, desto mehr verändert sich das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft: aus Vertrauen wird Gehorsam, aus Mitsprache wird Konsenspflicht.
Das Ergebnis ist ein System, das sich selbst stabilisiert, indem es instabil bleibt. Man könnte sagen: Der Staat braucht die Krise, um seine Macht zu rechtfertigen. Sobald Normalität eintritt, bricht die Logik zusammen. Also bleibt man lieber im Ausnahmezustand, kommunikativ, organisatorisch, emotional. Das ist kein deutsches Phänomen; es ist ein Trend der westlichen Welt. Doch in Deutschland trägt er eine besondere Schwere, weil man hier seit 1949 geschworen hat, genau das nie wieder zuzulassen: einen Staat, der seine Macht mit Sicherheitsargumenten über die Gesellschaft stellt.
Heute geschieht es nicht mit Stiefeln und Panzern, sondern mit PDFs, Pressekonferenzen und Verwaltungsakten. Die Demokratie wird nicht abgeschafft, sie wird verformt, durch permanente Ausnahme, nicht durch offenen Bruch. Und das ist vielleicht das Genialste und zugleich Tückischste an dieser Entwicklung: Sie braucht keinen Feind im Äußeren mehr. Sie findet ihn im Inneren, im Zweifel selbst.
Die Schraube dreht sich weiter, weil sie sich drehen kann. Es gibt keine Bremse, nur den Glauben, man handle im Guten. Aber Macht, die sich selbst legitimiert, verliert irgendwann jedes Maß. Und eine Gesellschaft, die sich an die ständige Spannung gewöhnt, erkennt die Überspannung nicht mehr.
Fazit: Demokratie im Dauerstress – oder der langsame Tod der Normalität
Am Ende dieses Weges steht kein Putsch, kein martialisches Trommeln, kein offener Staatsstreich. Am Ende steht ein Land, das sich Schritt für Schritt an seine eigene Unfreiheit gewöhnt hat und sie Krise nennt. Es sind nicht die Panzer, die Demokratien zerlegen, sondern die Paragrafen. Nicht der Befehlston, sondern der beruhigende Tonfall, mit dem man erklärt, „es sei alles zu unserem Schutz“.
Deutschland steht heute an einem Punkt, an dem sich sein Verhältnis zu Freiheit und Sicherheit neu sortiert. Die vergangenen Jahre haben eine gefährliche Lektion gelehrt: Je mehr Angst herrscht, desto größer ist die Bereitschaft, Macht zu delegieren, an Experten, Kommissionen, Sicherheitsräte. Was als Vorsorge begann, ist zu einer Ideologie geworden: Sicherheit als höchste Moral. Doch eine Gesellschaft, die sich der Sicherheit verschreibt, bezahlt mit etwas, das man nicht zurückbekommt, mit Vertrauen.
Das Vertrauen der Bürger, dass der Staat nicht jedes Problem mit Zwang löst. Das Vertrauen der Regierung, dass der Bürger vernünftig handeln kann, ohne überwacht zu werden. Und das Vertrauen zwischen den Menschen, das durch Dauerangst zersetzt wird. Wo Angst regiert, stirbt Solidarität.
Die Zivil-Militärische Zusammenarbeit 4.0, das Grünbuch ZMZ, die Spannungsfall-Rhetorik, sie alle sind keine isolierten Erscheinungen, sondern Bausteine eines neuen Paradigmas. Ein Staat, der seine Bevölkerung systematisch auf Krisen programmiert, produziert Untertanen, keine Bürger. Und ein politisches System, das sich an Ausnahmezustände gewöhnt, verliert irgendwann die Fähigkeit, Normalität zuzulassen. Der Übergang ist kaum sichtbar: ein Erlass hier, ein Gesetz dort, eine kleine Kompetenzverschiebung, bis am Ende niemand mehr sagen kann, wann das „Vorübergehende“ begonnen hat, dauerhaft zu werden.
Noch ist nichts verloren. Die Bundesrepublik hat starke Institutionen, ein Verfassungsgericht, kritische Journalisten, wachsame Bürger. Doch all das nützt nichts, wenn die Gesellschaft selbst abstumpft, wenn sie glaubt, Freiheit sei verhandelbar, solange man sie in Raten abgeben kann. Die entscheidende Verteidigungslinie verläuft nicht an den Außengrenzen, sondern im Inneren: in der Bereitschaft, jede neue „Notwendigkeit“ zu hinterfragen, bevor sie Gesetz wird.
Es braucht keine Revolution, um die Demokratie zu retten. Es braucht nur ein kollektives Nein, ein Nein zu der Vorstellung, dass Sicherheit ohne Freiheit möglich ist. Denn ein Staat, der sich in permanenter Spannung hält, verlernt zu leben. Und eine Gesellschaft, die diese Spannung akzeptiert, wird irgendwann glauben, dass Normalität selbst gefährlich sei.
Quellen und Anmerkungen:
Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (ZOES): Grünbuch Zivil-Militärische Zusammenarbeit 4.0 – Krisenvorsorge und Resilienz im militärischen Konfliktfall, Berlin 2025.
Link: https://zoes-bund.de/publikationen/gruenbuch-zmz
PVT – Publikation Volltext: Digitale Ausgabe des Grünbuchs (ZMZ 4.0), Januar 2025.
Link: https://www.pvtweb.de/fileadmin/user_upload-/Dateien_zum_Download/250115_Gruenbuch_ZMZ_digital.pdf
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK): Pressemitteilung zur „Weiterentwicklung der zivil-militärischen Zusammenarbeit“ vom 31. Januar 2025.
Link: https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/01/pm-31-zivil-militaerischer-zusammenarbeit.html
LabourNet Germany: „Zivilisten im Krieg werden nur nachrangig behandelt – Analyse des Grünbuchs ZMZ 4.0“, Februar 2025.
Link: https://www.labournet.de/interventionen/kriege/militarisierung-bw/gruenbuch-zivil-militaerische-zusammenarbeit-4-0-zivilisten-im-krieg-werden-nur-nachrangig-behandelt
Infosperber (Schweiz): „Wie sich Deutschland auf einen Krieg vorbereitet“, Analyse vom 12. März 2025.
Link: https://www.infosperber.ch/politik/wie-sich-deutschland-auf-einen-krieg-vorbereitet
Handelsblatt: „Drohnenvorfälle – CDU-Politiker Kiesewetter fordert Ausrufung des Spannungsfalls“, Artikel vom 7. Oktober 2025.
Link: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/drohnenvorfaelle-cdu-politiker-fordert-ausrufung-des-spannungsfalls/100158720.htm
Süddeutsche Zeitung: „Bundeswehr, Bundesregierung und der Spannungsfall – Kiesewetter legt nach“, Analyse vom 8. Oktober 2025.
Link: https://www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-bundesregierung-kiesewetter-spannungsfall-li.3319567
Focus Online: „Kiesewetter macht Bundeswehr-Vorschlag – Lanz skeptisch: ‚Keine triviale Sache‘“, Interview vom 8. Oktober 2025.
Link: https://www.focus.de/politik/kiesewetter-macht-bundeswehr-vorschlag-lanz-skeptisch-keine-triviale-sache_8874e163-ff1d-487b-9b16-f8ccc96fbf33.html
VDA / Prognos: „Employment in the automotive industry – Prognos study for VDA“, 2024 – als Referenz für Beschäftigungsstruktur und staatliche Subventionsmechanismen im Transformationskontext.
Link: https://www.vda.de/en/press/press-releases/2024/241029_Prognos_study_on_regarding_Employment_in_the_automotive_industry
Gesetze im Internet: Art. 80a GG, Notstandsgesetz.
Link: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_80a.html
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Mann in Soldatenuniform mit Richterhammer in der Hand
Bildquelle: Thx4Stock team / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut