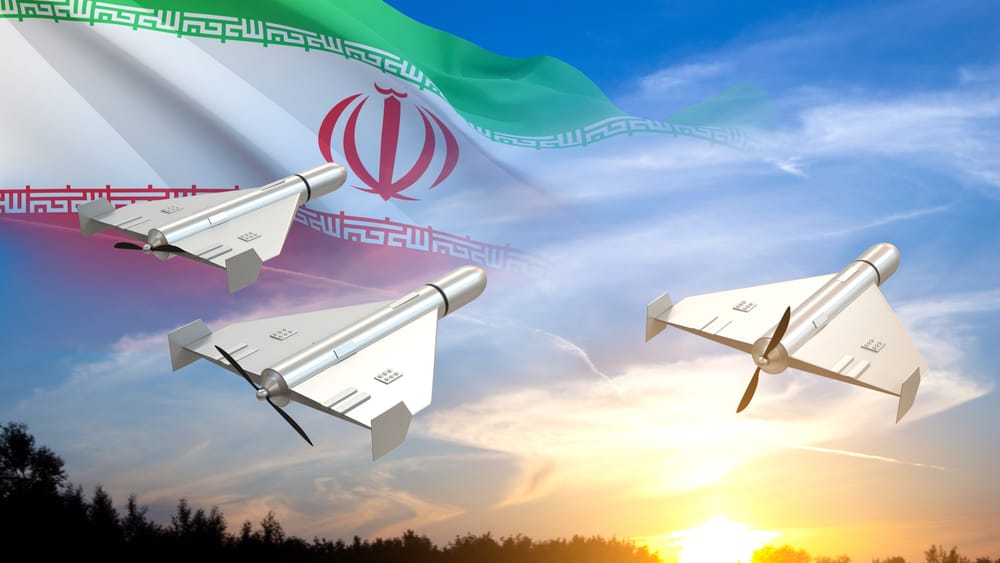Ein Auszug aus dem Buch von Günther Burbach.
1.2 Die Zeitenwende als politische Umcodierung
Im Kapitel „Die Zeitenwende als politische Umcodierung“ beleuchtet Günther Burbach, wie sich die deutsche Sprache in Bezug auf Krieg und Frieden seit dem 24. Februar 2022 radikal gewandelt hat. Die sogenannte Zeitenwende, wie sie von Bundeskanzler Olaf Scholz proklamiert wurde, markiert für Burbach nicht nur einen politischen Kurswechsel, sondern auch eine gezielte Verschiebung in der semantischen Aufladung zentraler Begriffe. Aus Pazifismus wird Passivität, aus Neutralität wird Schwäche. Der folgende Auszug zeigt eindringlich, wie dieser Prozess funktioniert und was er für eine Gesellschaft bedeutet, die glaubte, sich von der Sprache des Krieges emanzipiert zu haben:
Als Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag von einer „Zeitenwende“ sprach, markierte dies mehr als nur eine politische Kurskorrektur. Es war ein bewusster Akt der rhetorischen Umcodierung: Die Grundsätze deutscher Außen- und Sicherheitspolitik wurden nicht nur neu formuliert, sondern historisch aufgeladen und moralisch alternativlos gemacht. In der Rhetorik der Regierung wurde das militärische Handeln nicht bloß legitimiert, sondern zur historischen Pflicht erhoben. Die Sprache selbst wurde zur Waffe, zur Waffe gegen Zweifel, Zurückhaltung und Kritik.
Die Scholz-Rede war gespickt mit Begriffen, die Dringlichkeit, Verantwortung und Geschlossenheit suggerierten: „Putins Krieg“, „unser Land“, „historischer Moment“, „Wehrhaftigkeit“, „Solidarität“. Das Wort „Frieden“ tauchte nur am Rande auf und nie als Ziel durch Verhandlung, sondern stets als etwas, das durch militärische Stärke erreicht werden müsse. Auch der Begriff „Diplomatie“ wurde vermieden. Stattdessen dominierte die Idee, man müsse nun „entschlossen handeln“, „unsere Freiheit verteidigen“ und „endlich liefern“, sowohl rhetorisch als auch militärisch.
Diese Wortfelder sind kein Zufall. Sie sind Teil eines strategischen Framing-Prozesses, in dem Gewalt nicht als tragisches Scheitern erscheint, sondern als legitimes, ja notwendiges Mittel.
Kapitel 3.4 – Die Sprache des Feindes – Rhetorik, Metaphern, mediale Kriegsführung
In Kapitel 3.4 wirft Günther Burbach einen kritischen Blick auf die Rolle der Medien in Zeiten des Krieges. Er zeigt, wie mit Metaphern, moralischen Deutungsrahmen und gezielter Emotionalisierung ein geschlossenes Meinungsbild erzeugt wird, das kaum noch Raum für Ambivalenz oder Zweifel lässt. Der Beitrag thematisiert nicht nur die Sprache der Berichterstattung, sondern auch die Mechanismen der öffentlichen Ausgrenzung von Abweichlern.
Es geht nicht mehr um Argumente, sondern um Gesinnung. Die Frage lautet nicht: Was stimmt?, sondern: Auf wessen Seite stehst du?
Besonders deutlich wird dies in der Behandlung prominenter Stimmen, die nicht dem dominanten Narrativ folgen. Intellektuelle wie Ulrike Guérot oder Wolfgang Streeck, Journalisten wie Ulrich Teusch oder Daniela Dahn wurden in der öffentlichen Wahrnehmung marginalisiert oder gar stigmatisiert. Wer sich um Verständigung bemüht, wird nicht mehr als Mittler, sondern als Gefährder dargestellt.
Diese Entwicklung ist nicht nur alarmierend für die Pressefreiheit, sondern auch für die demokratische Debattenkultur insgesamt.
Die Mechanismen sind dabei subtil, aber wirksam. Bereits die Auswahl von Talkshow-Gästen folgt einem Muster: Zwei bis drei Vertreter des offiziellen Kurses, ein Gast mit abweichender Meinung, der jedoch oft wenig Redezeit erhält oder als schrill inszeniert wird.
Begriffe wie „Putinversteher“, „Querdenker“ oder „kremlnah“ dienen als diskursive Abrissbirnen, um Kritik zu diskreditieren, bevor sie inhaltlich diskutiert wird. Die Grenze zwischen journalistischer Einordnung und politischem Aktivismus verschwimmt zunehmend.
Hinzu kommt die Rolle der sozialen Medien. Viele Journalistinnen und Journalisten verstehen Twitter nicht mehr als Diskussionsraum, sondern als Tribunal. Likes, Retweets und Empörung ersetzen die gedruckte Debatte. Wer hier aus der Reihe tanzt, riskiert nicht nur Ansehen, sondern auch Karriere. Besonders junge Medienmacher orientieren sich an den großen Leitfiguren der Branche und vermeiden Risiken. Selbstzensur wird zur neuen Professionalität.
Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Sendungen wie Panorama, Frontal oder Monitor arbeiten mit moralisch stark aufgeladenen Narrativen. Die Berichterstattung über den Ukrainekrieg, aber auch über Themen wie Russland, China oder Friedensbewegungen folgt dabei oft einem Muster der Bestärkung und nicht der Befragung. Kritik an westlicher Politik wird selten inhaltlich aufgegriffen, sondern meist psychologisiert oder delegitimiert.
Die Konsequenz ist eine Verengung des Debattenraums. Die Angst, das Falsche zu sagen, erstickt den Mut, das Richtige zu fragen. Das journalistische Ethos der kritischen Distanz wird ersetzt durch ein Wir-Gefühl der moralischen Aufrüstung.
Diese Dynamik ist nicht neu, doch sie hat in Zeiten zunehmender Polarisierung eine neue Qualität erreicht.
Auszug aus Kapitel 9.5:
Im Abschnitt 9.5 widmet sich Günther Burbach einem besonders heiklen Thema: dem wachsenden Druck auf den Journalismus in Deutschland. Er beschreibt, wie sich die Berichterstattung seit Beginn des Ukraine-Krieges verändert hat, welche Mechanismen der indirekten Zensur wirken und warum immer mehr Journalisten in vorauseilendem Gehorsam nur noch das berichten, was in die politische Linie passt. Burbach stellt dabei keine reißerischen Behauptungen auf, sondern analysiert nüchtern und präzise den Zustand einer Branche, die zwischen Anpassung, Angst und moralischem Aktivismus schwankt.
Immer mehr Redaktionen in Deutschland wirken wie glattgeschliffene Echokammern einer politischen Linie, die kaum noch abweicht von dem, was Regierung und NATO vorgeben. Selbst renommierte Journalisten, die früher kritisch hinterfragten, passen sich heute an. Entweder aus Überzeugung, oder aus Angst, ihren Job zu verlieren. Die Mechanismen sind subtil: Kein offizieller Zensor ruft an. Es genügt, dass man weiß, was erwartet wird. Und was nicht. Wer abweicht, bekommt es zu spüren: durch Shitstorms, Karrierenachteile oder mediale Ächtung.
Dabei wird oft nicht offen zensiert, sondern vorab gefiltert. Themen, die dem Mainstream widersprechen, werden als „umstritten“ etikettiert, ohne sie je wirklich geprüft zu haben. Kritische Quellen gelten als „nicht vertrauenswürdig“, auch wenn sie im Einzelfall sauber recherchiert sind. In Talkshows sitzen immer dieselben Gäste, während alternative Stimmen fehlen. Und wenn sie doch eingeladen werden, dienen sie als Feigenblatt, oder werden wie bei Lanz, Illner oder Maischberger gezielt in die Defensive gedrängt.
Besonders bezeichnend ist der Umgang mit Zahlen und Begriffen. Während bei russischen Angriffen regelmäßig von „Kriegsverbrechen“ die Rede ist, nennt man ukrainische Beschüsse auf russische Städte „militärische Operationen“. Wenn ein Oppositionspolitiker in Russland verhaftet wird, heißt das „Putins Repressionsapparat“. Wenn Julian Assange 13 Jahre lang verfolgt wird, spricht kaum jemand von politischer Justiz. So wird Sprache zur Waffe und der Journalismus zum Helfer einer politischen Agenda.
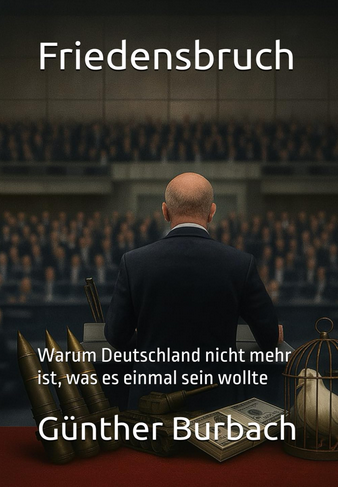
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Raketen vor deutscher Flagge
Bildquelle: Alones / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut