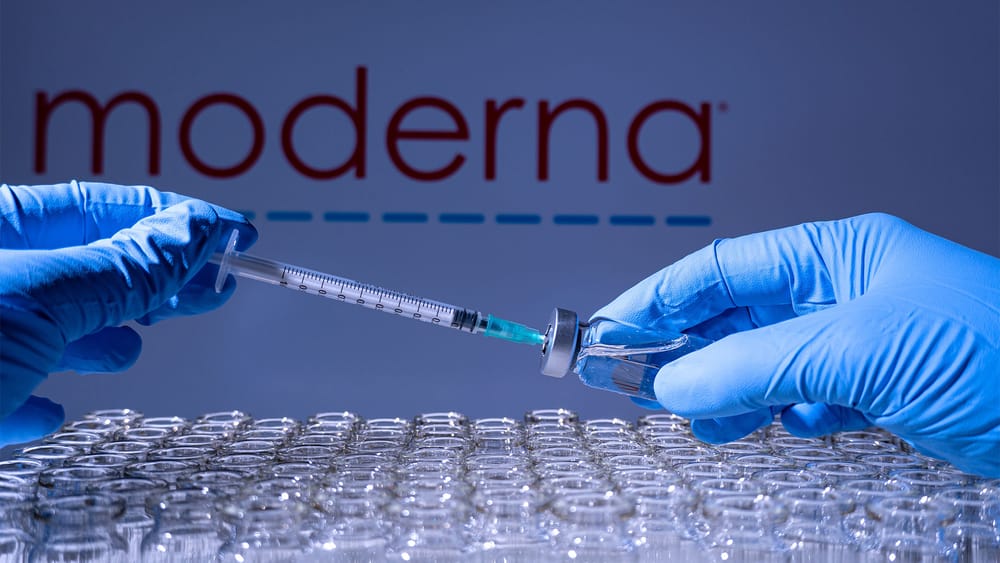Ein Meinungsbeitrag von Rüdiger Rauls.
Burn-out, Angststörungen sind wie auch Depressionen individuelle Belastungen von gesellschaftlichem Ausmaß. Die Gesellschaft versucht, irgendwie mit den Depressiven zurechtzukommen. Für die Betroffenen bedeutet es, sich auf dünnem Eis über Wasser zu halten.
Unbewusst
Die Umgebung wirkt nicht nur in Worten und Taten auf den Menschen ein, sondern auch durch Stimmungen. Das merken selbst die Erwachsenen noch. Auch sie können das Gefühl nur beschreiben, nicht aber erklären, das in ihnen entsteht beim Besuch einer Kirche oder beim Gang im Dunkeln durch den Wald. Dabei verfügen doch die Erwachsenen über die Möglichkeiten des Verstandes, Gefühle daran zu hindern, übermächtig zu werden. Um wie viel gewaltiger und mächtiger muss die Wirkung von Stimmungen bei einem Kleinkind sein, dem die Mittel der Vernunft und Beruhigung durch Selbsterklärung noch nicht zur Verfügung stehen?
Es spürt das mörderische Wüten des Hungers in sich, den es sich nicht erklären kann, den es nur wahrnimmt als etwas Bedrohliches, das immer unerträglicher wird, sich in ihm ausbreitet und es von innen zu zerreißen droht. Das spielt sich in seinem eigenen Inneren ab, und obwohl es aus ihm selbst kommt, ist es ihm hilflos ausgeliefert, wenn nicht die Hilfe von außen kommt. So ist es auch mit den Blähungen des eigenen Darms, mit Kälte und Lärm, die von außen kommen. Sie alle sind Bedrohungen, unerklärlich, unerträglich und unüberwindlich, wenn nicht Hilfe kommt.
Kommt diese Hilfe, ist alles gut. Kommt sie nicht, droht Untergang. Kommt die Hilfe immer wieder, entsteht ein Gefühl von Sicherheit. Im Kind wächst die Gewissheit, dass Hilfe kommen wird, denn sie kam bisher immer. Kommt sie wohlwollend und warmherzig, entsteht Vertrauen und ein Gefühl von Geborgenheit. Setzt die Hilfe dagegen häufig aus oder kommt widerwillig oder mit dem falschen Angebot, dann entstehen Verunsicherung, Unsicherheit, Zweifel und Angst. Kommt zu viel auf einmal, können Gefühle der Ohnmacht entstehen gegenüber einer Macht, die es nicht abwehren kann, der es ausgeliefert ist und von der es sich erdrückt fühlt.
Aus diesem Umgang des Umfelds mit dem Kleinkind und seinen Bedürfnissen entwickelt sich auch in ihm selbst ein Gefühl gegenüber diesem Umfeld. Es entsteht von sich aus in ihm wie der Hunger, und ebenso wächst es auch. Es unterliegt nicht der Kontrolle durch das Bewusstsein. Stattdessen entsteht ohne das Zutun des Kindes aus diesem weitgehend unbewussten (Er)Leben in der kindlichen Frühzeit ein Grundgefühl, sozusagen ein emotionales Grundrauschen, weitestgehend bedingt durch das Handeln des Umfeldes.
Dieses Grundgefühl verfestigt sich allmählich und wird immer mehr bestimmend für seine Einstellung zu seiner Umgebung. Es wird wesentliche Grundlage für seinen Umgang nicht nur mit diesem näheren Umfeld, sondern auch mit sich selbst und später mit der Welt drumherum. Diesem frühkindlichen Gefühl gilt es, wieder nahezukommen. Es ist der Schlüssel zu den Einstellungen, deren Grundlagen in früher Kindheit geschaffen wurden und unser weiteres Leben beeinflussen.
Der Satz
So wie das Umfeld auf das Kind und seine Bedürftigkeit reagiert hatte, ein solch entsprechendes Gefühl entwickelt es zu sich selbst. Auf der Basis dieses Grundgefühls entstehen mit seinen zunehmenden intellektuellen Fähigkeiten Ansichten, Erklärungen und Einstellungen über sein Umfeld, sein eigenes Verhalten und den Austausch zwischen beiden. Dieses Grundgefühl drückt sich entsprechend der Einfachheit seiner frühen Erlebniswelt und seiner Wahrnehmungsfähigkeiten in der Einfachheit eines Satzes aus. Diesen Satz gilt es für den Depressiven zu finden. Denn er ist die Grundlage der eigenen Selbsteinschätzung, des eigenen Selbstverständnisses. Er ist zutreffend für das eigene Lebensgefühl in der eigenen Frühzeit.
Die tragende weitreichende Bedeutung eines solchen treffenden Satzes wird beispielsweise in der Bibel deutlich. Sie beginnt mit der einfachen Aussage: „Am Anfang war das Wort“. Dieser Satz besticht durch seine Kürze und Klarheit, wenn man sich auf ihn einlässt, egal ob man religiös ist oder nicht. Auf dieser einfachen Aussage baut sich das Weltbild auf, das die Bibel entwirft. Dabei ist erst einmal unbedeutend, ob ihr Inhalt objektiv richtig ist. Aber der Satz ist der Ausgangspunkt für das Weltbild, das sich immer weiter entfaltet, mit immer neuen Darstellungen und Erklärungen der Welt.
An diese erste einfache Aussage schließt sich in der Bibel die nächste an: „Und das Wort ist Fleisch geworden.“ Nun baut sich eins auf dem anderen auf. Aus dem körperlosen Wort wurde also Handfestes, wurde Materie. „Am Anfang war das Wort“, ist die Grundlage auf der sich das Gedankengebäude errichtet, mit dem die Bibel, aber auch der religiöse Mensch sich die Welt erklärt. So wie die Bibel zurückgeht auf den Ursprung der Welt, wie sie ihn sieht, um sich die Welt zu erklären, so muss sich auch der depressive Mensch auf die Suche machen nach seinem Satz, der für seinen eigenen Lebensanfang steht.
Es geht darum, über diesen Satz wieder Anschluss zu finden an das Lebensgefühl seiner frühen Kindheit. Aus ihm leiten sich seine späteren Ansichten, Rückschlüsse und Erkenntnisse ab, aus denen seine späteren Gedankengebäude entstehen. Dabei geht es nicht so sehr um deren Inhalt, sondern um die Einstellung, mit der der junge Mensch die Ereignisse seines Lebens aufnimmt und verarbeitet. Sie führen ihn im Rückwärtsgang hin zum Ursprung seiner Depression. Welcher Satz stand an seinem Anfang und damit auch an ihrem?
In den meisten Fällen ist der Satz einfach, erschütternd einfach, einfach erschütternd, wenn er denn den Lebensnerv der frühkindlichen Zeit trifft. Die Welt des Kleinkindes ist einfach, weil klein und überschaubar. Auch seine intellektuellen Fähigkeiten sind noch kaum ausgeprägt. Aufgrund dieser materiellen Voraussetzungen ist auch der zutreffende Satz einfach. Er liefert keine differenzierte Analyse der Lebensumstände, unter denen das Kind ins Leben getreten ist.
Der Satz steht für ein einfaches Lebensgefühl. Aber in seiner Einfachheit ist er treffend, und wenn er den Menschen trifft und erschüttert, dann ist er richtig. Wenn der Satz auch einfach ist, so ist er nicht einfach zu finden. Darin besteht die Schwierigkeit der Aufgabe, und sie erfordert in erster Linie Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Denn unsere auf schnelle Ergebnisse ausgelegte Gesellschaft verlockt zu übereilter Zufriedenheit. Man muss den Satz wirken lassen, um zu erkennen, ob er stimmt.
Erwartungen
Der Satz offenbart nicht nur dieses gesuchte und verschollen geglaubte emotionale Grundrauschen aus der ersten Lebenszeit. In ihm offenbaren sich Einstellungen gegenüber dem Kind, Vorstellungen über seine Bedürfnisse und über Erziehung im Allgemeinen, die in seinem Umfeld seinerzeit vorherrschten. Sie sind eingebettet in das gesellschaftliche Denken der jeweiligen Zeit. Diese Vorgaben haben indirekt Einfluss auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind, denn sie tragen mit bei zu Verformungen der Elternliebe durch gesellschaftliche Einwirkungen.
In den 1950er Jahren waren Denken und Vorstellungen über Erziehung noch sehr stark geprägt von der Nazi-Zeit. Ihre Ideale waren weiterhin sehr bestimmend: „Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie Windhunde“ hatten auch noch Bedeutung in der Nachkriegszeit. Später machte sich das heraufziehende Wirtschaftswunder in den Ansichten über Erziehung und Kinder immer mehr bemerkbar. Sie sollten es zu etwas bringen im Leben, etwas darstellen. Es gab weitgehend klare Leitbilder, an denen sich Erziehung orientierte und die wenig in Frage gestellt wurden.
Aber nicht alle Kinder hatten die Voraussetzungen für Kruppstahl, Leder und Windhunde. Vor allem war ihnen das in der Wiege noch nicht anzusehen. Wenn schon nicht Kruppstahl, Leder oder Windhunde so sollte nach den Vorstellungen der neuen Zeit das eigene Kind zumindest ein Wunderkind sein: früh laufen und sprechen können, früh sauber sein, früher jedenfalls als die anderen. Aber auch dafür hatten nicht alle die Voraussetzungen, so sehr manche Eltern auch darauf drängten. Die Natur lässt sich nicht von elterlichen Vorstellungen und Bemühungen ins Handwerk pfuschen.
Aber für Kinder kann oftmals das, was die Eltern für das richtige halten, nicht das sein, was ihren Bedürfnissen entspricht, nicht ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen gerecht wird. Das gilt für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in allen Zeiten. Viele, deren Kindheit in den 1950er Jahren lag, scheiterten an diesen gesellschaftlichen Idealen und elterlichen Wünschen. Aus diesem Scheitern entstanden Einstellungen zu sich selbst: „Ich bin nicht richtig“. „Ich bin nicht so, wie ich sein soll“.
Selbstbilder
Es gelang ihnen oftmals nicht, die unrealistischen Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Diese Enttäuschung bekamen sie mehr oder weniger direkt zu spüren. Das war die Grundlage, das Grundgefühl, auf dem sich spätere Gedankengebäude aus Erklärungsversuchen, Theorien und Selbstvorwürfen über die eigenen Unzulänglichkeiten auftürmten. Zweifel und Verachtung sich selbst gegenüber wuchsen dann noch zusätzlich, wenn die eigenen guten Vorsätze trotz größter Bemühungen scheiterten. Sie verfestigten das Grundgefühl: „Ich bin nicht richtig.“
Mit fortschreitender Entwicklung des jungen Menschen leiteten sich aus diesem Grundgefühl weitere Erklärungen und Selbsteinschätzungen über erlebtes oder scheinbares eigenes Versagen ab. Die Lebenseinstellungen verzweigten sich, wurden unübersichtlicher, undurchsichtiger. Aus „Ich bin nicht richtig“ konnte werden: „Eigentlich müsste ich anders sein“. „Weil ich nicht so bin, wie ich sein sollte, werde ich nicht beachtet, abgelehnt, nicht geliebt.“ Sie führen zudem auch immer weiter weg von dem ursprünglichen Grundgefühl, auf das die meisten dieser Einstellungen zurückgehen.
„Keiner mag mich, und deshalb habe ich keine Freunde, habe ich keinen Partner, habe ich keinen Erfolg im Beruf.“ „Weil ich keine Freunde habe, habe ich auch keine Beziehungen, die mir beruflich weiterhelfen“. „Weil ich keinen Erfolg habe, will auch niemand etwas mit mir zu tun haben.“ „Nichts gelingt mir“. „Ich bin ein Versager“. Das schlägt dann gelegentlich um in: „Wer mit mir nichts zu tun haben will, der kann mir dann auch gestohlen bleiben“. Das macht es aber nicht besser. Die Selbstzweifel entfernen sich nur noch mehr von ihrem Ursprung.
All diese Gedankengänge bauen aufeinander auf und gehen zurück auf eine Grundeinstellung zu sich selbst. Aber die Herkunft dieser Einstellung ist immer weniger erkennbar, verliert sich immer mehr im Nebel der eigenen Vergangenheit. Sie wiederzufinden, wird teilweise auch erschwert durch den Wandel der Einstellungen im Wandel der Zeiten. Das Denken der 1950er Jahre ist inzwischen gesellschaftlich kaum noch erkennbar, deshalb auch nicht im derzeitigen Bewusstsein als Verursacher von Identitätsstörungen. Es wurde ersetzt durch andere, die nicht weniger problematisch sind, wie die derzeitige Überbetonung einer scheinbaren Wissenschaftlichkeit in der Kindererziehung.
Die Informationsflut des Internets ersetzt analytisches Denken und klaren Menschenverstand, ohne aber Orientierung zu bieten. Experten für Erziehungsfragen, die man nach dem aussucht, was man gerne hören will, ersetzen die Erfahrung und Gelassenheit von älteren Menschen. Idealistische Lehrsätze oder gar nichtssagende Worthülsen wie „tiefe Wurzeln - breite Flügel“ oder „Kinder an die Macht“ ersetzen die materialistische Analyse von Gegebenheiten und Entwicklungen.
Aber hinter all diesen Bemühungen von Eltern, auch wenn sie im Rückblick den Heutigen vielleicht schräg erscheinen, steht das Bestreben, das Beste für ihre Kinder zu wollen. Das darf nicht vergessen werden, auch wenn hier sehr viel von den Problemen frühkindlicher Entwicklung und Erziehung die Rede ist. Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht, und ihnen eine freundliche Zukunft ermöglichen.
All das geschieht unter dem herrschenden Bewusstsein der Zeit, die die Vorstellungen von Eltern und Gesellschaft über Kindheit, Erziehung und Zukunft prägen. Und nicht jede frühkindliche Störung führt automatisch zu Traumata und in die Depression. Das sind die wenigsten, und jeder Depressive hat ein ganzes Leben Zeit, seine Vergangenheit aufzuarbeiten.
Quellen und Anmerkungen:
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse.
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bildquelle: Rawpixel.com / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut