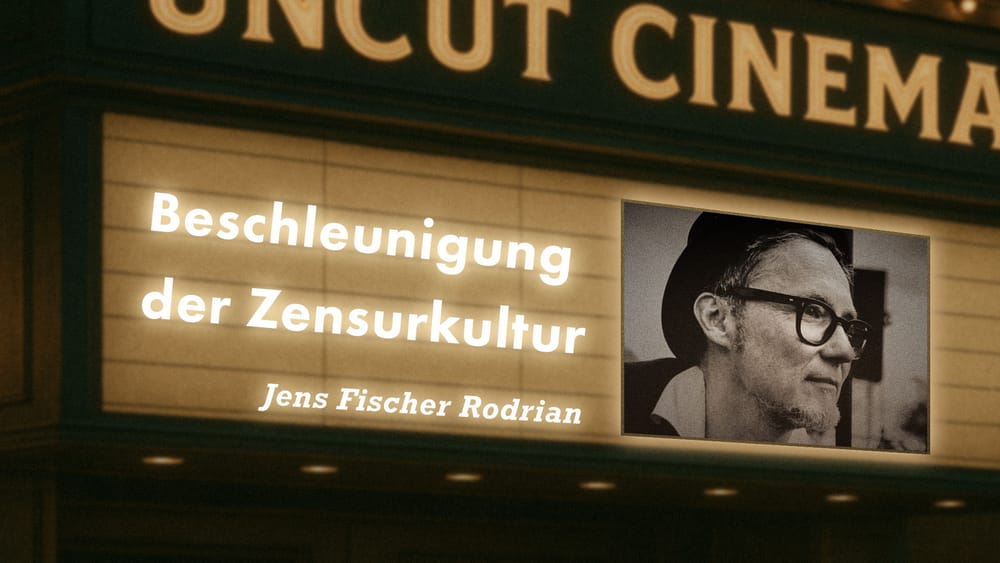Im Gegensatz zum Gipfel von Johannesburg 2023 hatte das diesjährige BRICS-Treffen in Rio de Janeiro wenig Aufsehen erregt wie auch schon das im russischen Kazan im vergangenen Jahr. Waren die Hoffnungen überzogen? Ist von BRICS also nicht mehr viel zu erwarten?
Ein Meinungsbeitrag von Rüdiger Rauls.
Falsche Voraussetzungen
Eines der grundlegenden Missverständnisse in Bezug auf den Staatenverband liegt bereits in der Namensgebung. Diese kam nicht von denen, die unter der Bezeichnung versammelt sind. Brasilien, Russland, Indien, China und später Südafrika wurden vom Westen zu den BRICS gemacht. Das Kürzel stammt von Jim O’Neill, dem Chefvolkswirt der US-Bank Goldman Sachs. Schon darin lag der Ursprung vieler Fehldeutungen. Westliches Denken hat aus den vier, später fünf Staaten etwas geschaffen, was es gar nicht gab und als solches gar nicht gedacht war: ein Block. Daran knüpften sich Bedrohungen für die einen, Erwartungen für die anderen.
Darin liegen auch viele Schwierigkeiten der Deutungen in Bezug auf die Politik dieser Staaten, ihrer Ziele und Verhältnisse untereinander. Besonders die Widersprüche werden immer wieder gerne von Meinungsmachern im politischen Westen hervorgehoben. Denn man will mit aller Macht die Entstehung einer Konkurrenz zur eigenen G7 verhindern. Das ist die große Angst und deshalb säen besonders die westlichen Medien Zwietracht, wo immer es ihnen möglich ist. Dass diese Widersprüche bestehen, dessen dürften sich die BRICS-Staaten bewusst gewesen sein, und gerade darin liegt ihre Stärke und ihre Vorbildfunktion: Miteinander auskommen trotz aller Unterschiedlichkeiten und sogar Differenzen.
Die BRICS-Staaten selbst hatten nicht die Absicht, eine Frontstellung gegen den Westen zu schaffen. Das betonen sie auch heute noch. Sie verstehen sich selbst nicht als festgefügten Block. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Grundlagen, Voraussetzungen und Interessen wäre ein solches Vorhaben sicherlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Anders als bei der NATO und der EU besteht kein Zwang zur Einigung, denn man will keine Machtpolitik gegenüber Dritten betreiben. Einzig die Aufnahme neuer Mitglieder wird einstimmig beschlossen, was auch sinnvoll ist, um eine weitgehend reibungslose Arbeit zu ermöglichen.
Weil der politische Westen selbst die BRICS zu einem Block erklärt hat, sieht man in ihm eine Bedrohung und versucht, diesen Block zu sprengen. Wieder einmal geht er dabei in die Falle des eigenen Denkens. Die Vorstellung, Russland sei schwach und seine von Putin unterdrückten Völker strebten nach westlichen Freiheiten, hat zum Konflikt in der Ukraine geführt. Die Vorstellung, Russland wolle die NATO angreifen, treibt die Aufrüstung. Und die Vorstellung, China sei genau so kriegerisch wie man selbst, hat zu dem selbst erteilten Auftrag geführt, Taiwan verteidigen und die Freiheit der Meere rund um China sicherstellen zu müssen. Der irrationale Blick des politischen Westens auf die Wirklichkeit ist die Ursache seiner irrationalen Entscheidungen.
Veränderte Voraussetzungen
Trotzdem ist es nicht ganz unberechtigt, in den BRICS eine Bedrohung zu sehen. Die Gefahr, die von dem Verband ausgeht, besteht nicht in seinen wirtschaftlichen oder militärischen Fähigkeiten. Die Bedrohung besteht in seinem Denken und Handeln, das er dem des Westens gegenüber stellt: Die Zusammenarbeit zum gemeinsamen Vorteil trotz aller Unterschiede. Das widerspricht der westlichen Herangehensweise, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der wachsenden Machtposition der USA einen zunehmend diktatorischen Stil offenbart. Die westlichen Bündnisse bestimmten mit den USA als Weltpolizist an der Spitze den Gang der Dinge – vor allem außerhalb des sozialistischen Blocks.
Zwar unterwarfen sich auch die engeren Partner der USA deren Diktat, aber gleichzeitig profitierten sie von deren Herrschaft über den Rest der Welt. Kaum ein Land löste wieder den Stachel der amerikanischen Ordnung, und wer es versuchte, bekam schnell die Macht der USA zu spüren. Denn diese waren der militärische, besonders aber der wirtschaftliche Zuchtmeister der westlichen Welt und hielten sie insofern zusammen. Das änderte sich mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas.
Zuerst nur Werkbank westlicher Konzerne zur Bedienung der Weltmärkte wuchs die Volksrepublik mehr und mehr heran zu einem eigenständigen Produzenten und Lieferanten. Aber besonders in den weniger entwickelten Ländern wurde China zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten, dem der Westen wenig entgegen zu setzen hatte. Die einfachen chinesische Produkte bedienten nicht nur westliche Märkte, sie wurden immer häufiger wegen ihrer niedrigen Preise auch zu Kassenschlagern auf den Märkten der Dritten Welt.
Westliche Unternehmen konnten diese Märkte nicht bedarfsgerecht bedienen, weil deren Erzeugnisse meistens zu teuer waren für finanzschwache Staaten. Hinzu kamen wirtschaftliche, finanzielle und politische Auflagen, die die Entwicklung dieser Länder nur zu den Bedingungen des Westens zulassen wollten. China stellte dazu eine Alternative dar. Die Produkte waren nicht nur billiger. Dass sie zu Beginn noch weniger hoch entwickelt waren als westliche, stellte eher einen Vorteil dar. Durch ihre Nähe zum Stand der Fertigkeiten in den Zielländern waren sie einfacher zu bedienen und zu warten.
Außerdem stellten Chinas Finanzierungsbedingungen gerade für finanzschwache und wirtschaftlich weniger entwickelte Staaten einen erheblichen Vorteil dar. Westliche Unternehmen rechneten auf der Basis westlicher Devisen, hauptsächlich in Dollar, ab, die für viele Entwicklungsländer schwer zu erwirtschaften waren. Die eigenen nationalen Währungen wurden in der Regel als Zahlungsmittel nicht angenommen. China dagegen bot neben den niedrigeren Preisen sehr oft auch die Bezahlung durch Rohstoffe als Gegenwert an. Denn auf die war die Volksrepublik angewiesen, um die eigene Wirtschaft zu entwickeln.
So entstand durch den Tauschhandel zwischen chinesischen Produkten und den Rohstoffen der Abnehmerländer eine Win-win-Situation, die ganz im Interesse beider Beteiligten war und auch zu der Entwicklung eines Denkens im beiderseitigen Vorteil mit beitrug. Im Gegensatz dazu wollte der Westen seine teuren Produkte verkaufen, zu denen es lange Zeit keine Alternative gegeben hatte, zuzüglich der Finanzierung in eigenen Währungen. Das war ein doppelter Gewinn im Interesse der westlichen Staaten und zum Nachteil der Entwicklungsländer.
Hier liegt der Ursprung der Verschuldung vieler Staaten der Dritten Welt. Sie wollten ihre Gesellschaften entwickeln und modernisieren. Sie waren angewiesen auf die westliche Technologie, die sehr teuer war. Um das finanzieren zu können, verschuldeten sie sich in westlichen Währungen, hauptsächlich in Dollar. Die USA aber waren der alleinige Herr über den Greenback. Änderte sich die amerikanische Geldpolitik entsprechend den US-Interessen, hatte das meistens Nachteile für die Schuldenländer. Stiegen in den USA die Zinsen, dann verteuerten sich die Kredite der Schuldnerländer, ihre Schuldenlast stieg.
Veränderte Bedingungen
Mittlerweile ist China der größte Handelspartner für die meisten Staaten der Welt. Aus den finanzstarken Ländern flossen die Dollars und Euros, aus den weniger reichen die Rohstoffe. Beispielsweise wird wegen der westlichen Sanktionen der Handel zwischen China und dem Iran in großem Umfang auf der Basis Öllieferungen abgewickelt. Aber der Handel in Yuan nimmt immer mehr zu, auch mit anderen Staaten, ebenso in lokalen Währungen. Dadurch entzieht sich der Handel allmählich der Beobachtung durch die USA und somit auch den Einflussmöglichkeiten und Behinderungen durch den politischen Westen und seine Institutionen.
Um aber ihre Rohstoffe erschließen und liefern zu können, war die Entwicklung der Infrastruktur in den finanzschwachen Länder Voraussetzung. Besonders in Afrika befanden sich viele Lagerstätten in Gebieten, die kaum über Verkehrsverbindungen verfügten. Die Eisenbahnen, die China in Afrika baute und nun auch in Südamerika, und die Häfen, die es modernisierte oder neu anlegte, dienten der Erschließung dieser Rohstoffe, den Zahlungsmitteln der ärmeren Staaten. Damit wurden sie von westlichen Unternehmen und Krediten unabhängiger.
Im Gegenzug brachten die neuen Verkehrsverbindungen chinesische Produkte bis tief hinein in die Herzen der Kontinente. Insofern hat die Belt and Road Initiative einen anderen Charakter als die eurasische Seidenstraße. Dient die erstere der weltweiten Erschließung von Rohstoffen und dem Ausbau von Lieferketten, so diente letztere besonders in der Anfangszeit dem Transport chinesischer Waren nach Europa. Die Eisenbahnrouten durch den eurasischen Raum beschleunigten den Warenverkehr und machten ihn unabhängiger von den Seewegen, die von der amerikanischen Marine bestrichen wurden.
Neue Lage
Diese Entwicklung war weitgehend ruhig verlaufen, wohl immer auch begleitet von Versuchen westlicher Staaten, Erfolge und Fortschritte der BRICS zu behindern, und der weitgehend negativen Berichterstattung ihrer Medien. Doch erst die heftigen Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukrainekrieges machten deutlich, wie sehr auch sie immer noch den westlichen Finanzmärkten und ihrer Infrastruktur ausgeliefert waren. Wirtschaftlich war zwar in China eine Alternative zum politischen Westen entstanden, jedoch die Finanzmärkte waren fest in der Hand der USA und ihres Dollars geblieben.
Vorher hatten diese Abhängigkeit schon der Iran, Venezuela und der ein oder andere sogenannte Schurkenstaat zu spüren bekommen. Dass man aber nun auch einen der führenden Industriestaaten wie Russland angriff, machte die Bedrohungslage für alle anderen deutlich. Der politische Westen schreckte nicht mehr davor zurück, unter Inkaufnahme von Schäden für die eigene Wirtschaft und Bevölkerung Maßnahmen zu ergreifen, die die gesamte Finanzinfrastruktur und den Welthandel in Gefahr bringen konnten, vom Ausbruch eines globalen Krieges einmal ganz abgesehen.
Unter dem Schock dieser Erkenntnis stand 2023 der Gipfel in Johannesburg. Schon vorher waren nicht nur in BRICS-Staaten sondern auch weltweit Modelle der Abkehr vom Dollar diskutiert worden. Dabei stellte sich bald heraus, dass ein Ersatz des Greenback als weltweite Finanz- und Handelswährung nicht so leicht und schnell möglich ist. Einem einheitlichen BRICS-Zahlungsmittel wurde selbst vom russischen Präsidenten Putin im Zuge des Kasan-Gipfels von 2024 eine Absage erteilt. Dafür waren die Voraussetzungen in einzelnen BRICS-Staaten aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit noch nicht gegeben.
Zwei Entwicklungsstränge deuten sich mittlerweile an. Einerseits treibt man die Ausweitung des Verbandes durch neue Mitglieder voran, erweitert durch einen Kreis von Aufnahmeinteressenten als sogenannte Partnerstaaten. Unklar bei diesem Verfahren sind die Kriterien, nach denen über die Aufnahme entschieden wird. Welche Überlegungen stehen zum Beispiel hinter dem Beitritt Äthiopiens, welche Vorteile bringt es für den Verband? Da BRICS nur ein sehr loses Bündnis ist, ist auch nicht direkt erkennbar, welche Vorteile für die einzelnen Staaten und ihre Volkswirtschaften in dieser Mitgliedschaft bestehen. Denn die meisten Vereinbarungen und Verträge werden zwischen den Einzelstaaten getroffen. Die BRICS-Mitgliedschaft lässt keine besonderen Bedingungen oder Vergünstigungen dabei erkennen.
Die zweite Richtung der Entwicklung wurde in Rio de Janeiro deutlicher herausgearbeitet. Es geht um die Schaffung von Alternativen zur westlichen Finanzinfrastruktur. Die zwischenstaatliche Zahlungsabwicklung wird zunehmend in nationalen Währungen abgewickelt und über eigene Verrechnungssysteme. China und Russland gehen dabei beispielhaft voran und stellen ihre Erfahrungen auch den anderen BRICS-Staaten zur Verfügung. Daneben sollen eigene Mechanismen geschaffen werden für Versicherungen und Finanzinvestitionen, die weitgehend unabhängig sind von westlichen Unternehmen und Einrichtungen. Denn der Zugang zu den Finanzmärkten und ihrem Kapital ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die schnellere Entwicklung der Volkswirtschaften in den BRICS-Ländern.
Quellen und Anmerkungen
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse.
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.
+++
Bild: Brasiliens Präsident Lula da Silva auf dem BRICS-Gipfel 2025 in Rio de Janeiro
Bildquelle: Antonio Scorza / shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut