von Susan Bonath.
Die Ressourcen schwinden, die Umwelt leidet, die Armut wächst und der Reichtum sammelt sich in wenigen Händen. Es drohen schlimmere Katastrophen als je zuvor. Und wir sehen zu. Oder?
Wir leben in bedenklichen Krisenzeiten. Unser System zwingt die Wirtschaft, ständig zu wachsen, und das immer schneller. Der Planet leidet: Ressourcen schwinden, Regionen verwüsten, Millionen Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. Während sich auf der einen Seite das Elend ausbreitet, sammelt sich in wenigen Händen immer mehr Reichtum. Diese Macht wollen die Profiteure keinesfalls hergeben. Karawanen von Lobbyisten gehen in den Parlamenten aller Staaten ein und aus. Ihre Interessen sind die Grundlage fast aller Gesetze. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Doch die Katastrophe hat längst begonnen. Geht es so weiter, dürfte sie bald ein ungeahntes Ausmaß erreichen.
Viele werden bis hierher zustimmen. Um so unterschiedlicher wird reagiert. Die einen rufen nach einem starken Staat. Der möge ihnen als angestammten Staatsbürgern bitteschön helfen. Vor steigender Kriminalität zum Beispiel. Die Flüchtlinge sollen raus. Dabei weiß jeder Soziologe, dass Kriminalität mit den sozialen Missständen zunimmt, und nicht umgekehrt. Andere halten nicht viel von solch autoritären Ansätzen. Der Staat möge die Reichen höher besteuern und das Geld nach unten umverteilen. Hartgesottene Linke finden sogar, die gesamte Wirtschaft gehöre in öffentliche Hand.
Es sind die sozialen Verwerfungen, die immer mehr Menschen überall auf der Welt zu schaffen machen. Viele noch gut Situierte versetzt die Entwicklung in pure Angst, dort landen zu können, wo sie immer mehr Mitbürger vorfinden. Sie sollen immer mehr arbeiten, immer mehr bezahlen. Wut macht sich breit, oder Resignation. Das lässt Zorn und Hass erblühen. Vor allem aber treibt es immer mehr Menschen auf die Suche nach dem vermeintlichen Feind, an dem sie Rache nehmen können.
Herrschaft und Gewalt
Um die Ursache für die sozialen Verwerfungen herauszufinden, ist ein Blick in die Geschichte nötig. Seit etwa einer Viertelmillion Jahren wuselt der »moderne Mensch« auf dem Planeten rum. Vor acht oder siebentausend Jahren begann er sich staatlich zu organisieren. Der Fortschritt machte Arbeitsteilung bald notwendig. Die Frage nach dem Eigentum kam hinzu. Wem gehört was und wem gehört nichts? Wer hat Zugang zu Ressourcen und wer nicht? Die strukturelle Herrschaft von Menschen über den Menschen in einer organisierten Gesellschaft nahm ihren unheilvollen Lauf.
Ein Beispiel: Wer Land besaß, konnte jene, die keins besaßen, für sich arbeiten lassen. Mit der Erschließung der Metallurgie geriet die Gewaltspirale in neue Turbulenzen. Wer Zugang zu Kupfer, Silber, Gold und später Eisen hatte, konnte aufrüsten, Kriege führen, Gebiete und Menschen erobern. Eine Ober- und Unterschicht bildete sich heraus. Eine Epoche der gewaltsamen Unterdrückung dauert bis heute an.
Im Feudalismus regierte der Feudaladel mit Königen, Kaisern, Fürsten oder Zaren an der Spitze. Die Eigentumsrechte aus der Zeit des alten Roms brachten es mit sich, dass einige reiche Bürger immer reicher wurden. In ihren Händen sammelte sich nach und nach mehr Vermögen, als Feudalherren besaßen. Die Herrscher begannen, sich Geld von ihnen zu leihen, um Eroberungszüge zu finanzieren. Beide wurden voneinander abhängig. Der moderne Staat wuchs. Er musste seine Geldquelle am Laufen halten.
Ein Beispiel sind die Handelshäuser in Genua und Venedig um 1300, ein weiteres die Ostindienkompanien um 1600. Letztere waren die ersten Aktiengesellschaften. Ihr einziges Ziel war es, aus Geld mehr Geld zu machen, kurz: Kapital zu akkumulieren. Sie läuteten die Geburtsstunde erster kapitalistischer Strukturen ein. Es wurde nötig, Staatsapparate auf- und auszubauen, um die Maschine zu füttern: Mehr Geld, mehr Macht. Jeder hatte der Maschine zu dienen, durch Lohnarbeit, mit seinen Steuern auf der einen, an den Hebeln der Macht auf der anderen Seite. Mit Gesetzen und brutaler militärischer Gewalt trieb der Staat dies voran.
Staat und Kapital
Das zeigt: Die heutigen Staaten sind die notwendige Folge bürgerlicher Herrschaft durch Kapitalbesitz. Beides ist nicht zu trennen. Beide sind voneinander abhängig und miteinander gewachsen. Von Anfang an hatten die Staaten keine andere Aufgabe, als die Herrschaft einiger über viele zu erhalten, zu sichern und in einen gesetzlichen Rahmen zu pressen, ob mittels Monarchie oder später, nach der französischen Revolution, durch bürgerlich-parlamentarische Demokratie oder Faschismus.
Von Beginn an waren die größten Akteure im kapitalistischen Markt, vor allem im Handel und Geldwesen, international aktiv. Nicht nur Raubzüge, Plünderungen und Versklavung standen auf ihrer Tagesordnung, auch Ex- und Import. Die industrielle Revolution beschleunigte die Expansion – nach und nach unterwarfen die Herrschenden immer mehr Gebiete ihrem Markt.
Der Widerspruch: Nach der Logik des Kapitalismus muss die Wirtschaft ständig wachsen. Dies zu garantieren, ist die Aufgabe von Staaten. Das ist effektiver, als wenn jeder Kapitalist selbst dafür sorgen müsste. Nicht ohne Grund bezeichnete Friedrich Engels seinerzeit den Staat als »ideellen Gesamtkapitalisten«. So sorgten die Herrschenden in der Bundesrepublik etwa dafür, dass sich das Bruttoinlandsprodukt von 1991 bis 2016 auf 3,1 Billionen Euro mehr als verdoppeln konnte.
Doch was produziert wird, muss auf dem Markt abgesetzt werden, damit der Profit fließt. Wenn jeder im eigenen Land einen Kühlschrank besitzt – oder sich die Hälfte einen leisten kann – dann muss die Kühlschrankfabrik trotzdem Kühlschränke absetzen und zwar immer mehr. Sinkt der Absatz im Binnenmarkt, rutscht das national agierende Kapital in die Verwertungskrise – wenn es nichts unternimmt.
Kapital auf Expansionskurs
Auf eine solche Krise reagieren die Unternehmer zwangsläufig mit Expansion. Sie müssen die Produkte woanders loswerden. Sie müssen Märkte erobern, indem sie Konkurrenten ausstechen, einverleiben oder ganze Länder zerstören, um sie unter ihre Herrschaft zu zwingen. Letzteres übernehmen die staatlichen Armeen. Auf ihrem Expansionskurs wachsen Konzerne, verschmelzen miteinander, gewinnen immer größeren Einfluss auf den globalen Warenverkehr. Die Monopolisierung schreitet voran. Es ist live erlebbar.
Die Konzerne exportieren nicht nur Waren, sondern auch Kapital. Heißt: Sie bauen Fabriken in Ländern, wo mehr Ausbeutung möglich und zugleich Absatz möglich ist. Sie kaufen Agrarflächen auf, um Bananen oder Reis selbst zu produzieren. Die Textilfabriken stehen heute dort, wo Baumwolle geerntet wird. Das ist billiger, effektiver, sichert den Profit und nennt sich Imperialismus.
So werden Bayer und Monsanto eins, Rüstungsunternehmen verschmelzen zu internationalen Megakonzernen. Und die Staaten ziehen mit. Imperialistische Staatenbündnisse wie die USA und die EU sind Ergebnis dessen. Das »Verteidigungsbündnis« NATO setzt gemeinsame Interessen kriegerisch durch. Alle Staaten im Verbund profitieren davon. Das ist ein Grund, warum die deutsche Regierung nicht freiwillig aus der NATO aussteigen wird – und warum die Mitgliedschaft auch anderswo begehrt ist.
Trügerische Ruhe im imperialistischen Verbund
Die Staaten- und Kapitalbündnisse befördern nicht nur Kriege in der imperialistischen Peripherie. Sie unterwerfen nicht nur ein Land nach dem anderen dem expandierenden Markt der Global Player. Es gibt einen Nebeneffekt: Diese Bündnisse befördern zugleich die militärische Waffenruhe innerhalb der Verbünde. Das liegt im Interesse der staatlichen und wirtschaftlichen Player. Die Abhängigkeit ist freiwillig und selbst gemacht. Freilich ist dies ein wankendes Schiff; irgendwann wird es den nächsten Eisberg rammen.
Diese Tatsache führt zu zahlreichen Fehlannahmen. Dank staatlicher Propaganda äußern sie sich in verschiedensten politischen Ideologien, nicht nur im neoliberalen, auch im bürgerlich-liberalen Spektrum.So forderten auch Grüne und SPD bereits den Aufbau einer EU-Armee, um »den Frieden in Europa noch effektiver zu sichern«. Dass dieser Frieden auf dem Rücken aller »kleinen Leute« fußt, wird ausgeblendet.
Faschismus durch die Hintertür?
Selbst viele, die sich als links bezeichnen, verfallen zuweilen dieser Rhetorik. Von klassisch linker Kritik an Eigentums- und Machtverhältnissen bleibt dabei nicht viel übrig. Dazu gehören nicht nur linksliberale Transatlantiker, sondern auch antinationale und antideutsche Strömungen. Letztere treten häufig als »Antifa« auf. Tatsächlich haben sie mit der einstigen Antifa – die es durchaus noch gibt – nicht viel zu tun. Sie lobpreisen den Imperialismus nicht nur, weil er vermeintlich Frieden schafft. Ihrer Meinung nach bannt die wirtschaftliche Verschmelzung die Gefahr der Entstehung nationaler faschistischer Regime.
Die Antideutschen fokussieren hierbei stur auf Deutschland. Ihr Blick ist verengt auf dessen spezielle faschistische Entwicklung inklusive industrieller Menschenvernichtung. Deutschland gehöre aufgelöst – oder gar zerbombt; die USA (als Befreier) und Israel verklären sie hingegen zum heiligen Hort der Demokratie.
Mit politischer und historischer Analyse hat das nichts zu tun. Die vermeintliche Eintracht in imperialistischen Bündnissen ist teuer erkauft. Die Wirtschaftskriege toben in der Peripherie, treiben Millionen Menschen in die Flucht. Die Herrschenden globalisieren nicht die Menschlichkeit, sondern ihren Markt. Sie globalisieren die koordinierte Ausbeutung. Wer sich nicht unterwirft, wird vernichtet. Und wer sich unterworfen hat, bekommt die Folgen zu spüren: Wachsende soziale Ungleichheit und eine schnell reicher werdende Oberklasse.
Globalisiert werden könnte durchaus auch der Faschismus. Auch im Europa des frühen 20. Jahrhunderts dehnte er sich schnell über die nationalen Grenzen hinweg aus. Sein Ziel war es, die Welt unter den Imperien neu aufzuteilen. Vor allem aber sollte er den mächtigsten Global Playern in Zeiten von Rezession, Arbeitslosigkeit und Inflation die ökonomische Macht sichern. Hier sind derzeit wieder viele Fragen offen.
Zu befürchten ist seine Rückkehr allemal. Schon jetzt sind Staaten diesseits und jenseits des großen Teiches dabei, ein faschistisches Element nach dem anderen einzuführen: Aufrüstung, repressive Gesetze, Verbote, politische Verfolgung, Sanktionen gegen Erwerbslose, mehr Befugnisse für die Polizei, kurz: Aufbau eines autoritären Staatsregimes. Ein solches, und das ist besonders gefährlich, findet in Krisenzeiten immer großen Zuspruch in den unteren Schichten. Doch sicher ist eins: Es wird sie am Ende mit repressiver Gewalt unterdrücken – zugunsten der Herrschenden.
Souverän im Machtgeplänkel?
Die Forderungen nach einem souveränen Staat sind allgegenwärtig. Sie implizieren, der Staat sei nicht souverän. Das stimmt zwar zum Teil, aber nicht nur für Deutschland. Allein durch die ökonomische Verquickungen sind nicht einmal die USA völlig souverän. Aber der beliebte Opfermythos entbehrt jeder Grundlage: Die BRD-Regierung kann sehr wohl eigene Entscheidungen treffen. 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sie sich an keinem Angriffskrieg. Die USA konnten sie nicht dazu zwingen. Entscheidet sich die Bundesregierung heute anders, dann nur, weil sie sich eigene Vorteile davon verspricht.
Dies zeigt: Deutschland wird nicht von den USA in den Krieg gezwungen, wie viele glauben. Deutschland vertritt höchst eigene Interessen. Die deutschen Soldaten sichern zunächst einmal Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann und Co. die Absatzmärkte. Sie sichern Exporte und Umsätze. Sie sichern Profite für die deutsche Industrie. Deutschland hat keinen Grund, nicht mitzumachen.
Drittens wird dabei der Wunsch laut, der deutsche Staat möge sich mehr um »die Deutschen« kümmern. Die Sehnsucht nach autoritärer Führung wird deutlich, häufig verbunden mit einer Heiligsprechung von Militär und Polizei. Der Sündenbock wird unten ausgemacht. Schuld seien die Opfer imperialistischer Innen- und Außenpolitik. Einmal sind es die angeblich faulen Arbeitslosen. Ein anderes Mal die Vertriebenen.
Die Hoffnung aber, es wäre mehr Geld für Sozialleistungen da, wenn Deutschland souverän alle Flüchtlinge ausweisen würde, ist vergeblich. Schon immer haben die Herrschenden diese so niedrig wie möglich und gerade so hoch wie nötig gehalten.
Die Bundesrepublik begann bereits in den 1970ern ihren sozialen Kahlschlag. Damals beklagte sie erstmals nach dem Wirtschaftswunder – das übrigens vor allem dem Wiederaufbau und den erlassenen Reparationen durch Nachbarländer, wie Griechenland zu verdanken ist – eine Massenerwerbslosigkeit. Die Quote Betroffener hatte die gefürchtete Eine-Million-Marke überschritten. Debatten über deren angebliche Faulheit in Funk und Fernsehen sollten die wahre Ursache verschleiern. Es war die Profitkrise, denn mit dieser fallen immer die Sozialleistungen und Löhne.
Globalisierung und Monopolisierung
Dennoch verknüpfen nicht wenige den Wunsch nach Frieden mit dem Wunsch nach souveräner, autoritärer Staatspolitik. Oder umgekehrt. So als würde die Bundesregierung gar keine eigenen, bzw. nicht ausschließlich die Interessen des national ansässigen Kapitals vertreten, wenn sie die deutsche Armee mit der NATO auf Geheiß der USA in den Krieg befiehlt. Und ganz so, als wären die Herrschenden in Wahrheit heilfroh, wenn die USA endlich nicht mehr diktieren könne. Und ganz so, als wäre es ihre Hauptaufgabe, den Frieden für ihre Bürger zu sichern. Wie gesagt, das ist ein Irrglaube.
Verfechter des souveränen Staats sind außerdem Globalisierungsgegner. Dass die Globalisierung kein humaner Akt ist, kann natürlich jeder erkennen. Dennoch: Sie ist vor allem ein ökonomischer Prozess, bei welchem die Staaten als Instrumente der Kapitaleigner lediglich mitziehen.
Globalisierung heißt zugleich Monopolisierung. Die Staatsapparate passen ihre Politik einfach an. Nicht nur der Wachstumszwang treibt den Prozess voran. Auch die immer komplexere Fertigung und Arbeitsteilung macht eine Kooperation in und Zusammenschlüsse von großen Konzernen nötig. Globalisierung dient der wirtschaftlichen Effizienz. Dieser Prozess ist nicht aufzuhalten. Und schließlich birgt er auch ein Phänomen: Große Konzerne können besser zahlen. Und tun es häufig auch. Sie haben viel mehr Mittel zur Verfügung.
Zurück zu »kleinteiliger Marktwirtschaft«?
Die Gefahr einer solchen Globalisierung sehen viele zu Recht. Das weckt bei vielen den Wunsch nach einem kleinteiligen Markt. Man müsse zurück zu kleinen Betrieben in freier Konkurrenz. Das impliziert, dass es irgendwann einmal eine Zeit gegeben habe, in welcher fröhlich lauter freie Kleinstkapitalisten nebeneinander her gewuselt, frei und einträchtig hin und her getauscht hätten auf einem »natürlich gewachsenen Markt«.
Leider ist auch das ein Mythos, den vor allem die Rechtslibertären pflegen wie ein Baby. Den Markt etablierten einst die alten Griechen. Um stehende Heere auf Raubzüge schicken zu können, war es nötig, auf Geldwirtschaft umzusteigen. Um lange Nahrungsmitteltransporte zu vermeiden, mussten Söldner dafür mit Münzen bezahlt werden. Damit sie sich dafür etwas kaufen konnten, pressten die Herrschenden Steuern ab. Sie zwangen so die Bauern und Handwerker, den Soldaten, ihren Unterdrückern mithin, etwas zu verkaufen. Taten die es nicht, drohte die Enteignung.
Auch im Kapitalismus gab es niemals einen solchen kleinteiligen Markt. Der Kapitalismus entstand ursächlich durch wachsenden Kapitalbesitz einzelner Bürger. Der Großkapitalist, der mehr besaß, als der Feudalherrscher, läutete seine Geburt ein, nicht die kleinen Handwerker und Bauern, die es auch im Feudalismus gab. Letztere hatten zumeist das Nachsehen. Spätestens im Industriezeitalter hielten die meisten von ihnen der reichen Konkurrenz nicht stand. Maschinen und Fabriken konnten sie sich gar nicht leisten. Viele wurden in die Lohnarbeit gezwungen.
Heute ein Zurück in eine Zeit, die es nie wirklich gab, zu propagieren, würde auch bedeuten, die Effizienz der Großproduktion aufzugeben. In einigen Bereichen der Landwirtschaft wäre dies wohl nötig, Stichwort: Massentierhaltung. Doch fast acht Milliarden Menschen mit heutigem Standard zu versorgen, erfordert in vielen Branchen Effizienz. Der technische Fortschritt hat den Wunsch längst überholt.
Wem gehört was?
Die Fragen, die man sich hier stellen muss, sind andere: Wem gehören die Fabriken, Maschinen, Rohstoffe, Agrarflächen? Das ist leicht zu beantworten: Sie gehören reichen Einzelpersonen, nicht der Allgemeinheit. Doch ist das gut? Die Folgen sehen wir: Fabriken produzieren einzig um des Profits willen. Alles, was sich irgendwie vermarkten lässt, ist gut dafür, ob Backwaren, Lottoscheine oder Rüstungsgüter.
Es geht nicht darum, was gebraucht wird. Ob gerade tausende Kinder im Jemen verhungern und an Krankheiten sterben, oder ob Obdachlose im deutschen Winter erfrieren, spielt keine Rolle. Der Dollar muss rollen, oder der Rubel, und zwar auf die Konten der Privatiers. Sollten wir das zulassen? Muss das so sein? Wer diese Frage mit nein beantworten kann, sollte hier weiter denken. Eine der wichtigsten Fragen für die Zukunft, für die Zukunft der Menschheit, dürfte sein: Wem soll die Wirtschaft gehören? Denn wem sie gehört, der bestimmt, was produziert und wie es verteilt wird – kein anderer.
Danke an die Autorin für das Recht zur Veröffentlichung des Artikels.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/









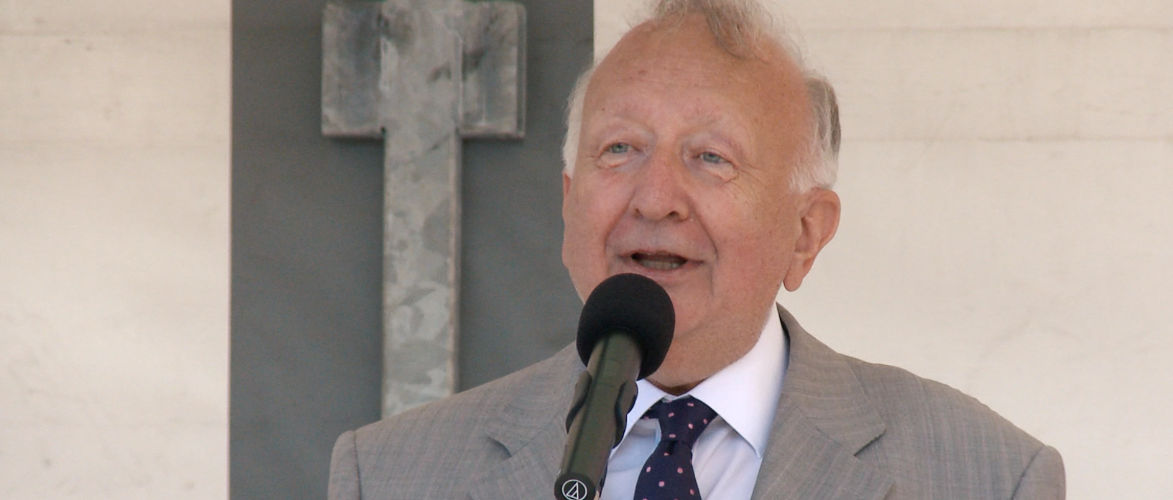
Kommentare (23)